| :**𓅓1𓄿1** | :𓅓𓄿 |  |
| :𓎆 | :𓎆 |    |
| :𓏾 | :𓏾 |  |
| :𓐀 | :𓐀 |  |
| :𓐂 | :𓐂 |  |
| 𓀀3 | 𓀀 |   |
| 𓀀:𓈖 |   | |
| 𓀁 | 𓀁 |                                                                |
| 𓀁1 | 𓀁 |  |
| 𓀁° | 𓀁 |                        |
| 𓀎 | 𓀎 |  |
| 𓀎𓏰:𓀀𓀁 | 𓀎𓀁 |  |
| 𓀐 | 𓀐 |                                          |
| 𓀐1 | 𓀐 |   |
| 𓀔 | 𓀔 |                      |
| 𓀗 | 𓀗 |     |
| 𓀢2 | 𓀢 |  |
| 𓀨 | 𓀨 |   |
| 𓀹1 | 𓀹 |  |
| 𓀼 | 𓀼 |   |
| 𓁐9 | 𓁐 |  |
| 𓁗1 | 𓁗 |   |
| 𓁗1:° | 𓁗 |  |
| 𓁶𓏤1 | 𓁶𓏤 |      |
| 𓁶𓏤1𓊪1 | 𓁶𓏤𓊪 |  |
| 𓁶𓏤1𓊪1:° | 𓁶𓏤𓊪 |    |
| 𓁷𓏤 | 𓁷𓏤 |                     |
| 𓁷𓏤1𓀀3 | 𓁷𓏤𓀀 |   |
| 𓁹:𓂋*𓏭 |                                                                   | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑 | 𓆑 |                 |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑1 | 𓆑 |    |
| 𓁹:𓏏*𓏤𓁻1 | 𓁻 |   |
| 𓁻2 | 𓁻 |  |
| 𓁻:° | 𓁻 |           |
| 𓂊2:° | 𓂊 |   |
| 𓂋 | 𓂋 |               |
| 𓂋1 | 𓂋 |                                                                         |
| 𓂋1𓂋:𓎡° | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓏥𓏲 | 𓂋𓏲 |     |
| 𓂋3𓌥 | 𓂋𓌥 |    |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1'𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲 |   |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲𓏲 |  |
| 𓂋:𓂋 |  | |
| 𓂋:𓂧 |      | |
| 𓂋:𓂧:° |  | |
| 𓂋:𓂧:°𓌗1 | 𓌗 |  |
| 𓂋:𓂧@ |   | |
| 𓂋:𓂧@𓂾𓂾 | 𓂾𓂾 |   |
| 𓂋:𓂧𓂾𓂾 | 𓂾𓂾 |  |
| 𓂋:𓂧𓌗1 | 𓌗 |    |
| 𓂋:𓂧𓌗2 | 𓌗 |  |
| 𓂋:𓊪 |    | |
| 𓂋:𓍿𓀀𓏪 | 𓀀𓏪 |         |
| 𓂋:𓎡 |  | |
| 𓂋:𓎡° |  | |
| 𓂋:𓏏*𓏰 |            | |
| 𓂋:𓏥𓏲 | 𓏲 |     |
| 𓂋:𓐍 |   | |
| 𓂓𓏤1 | 𓂓𓏤 |  |
| 𓂓𓏤2 | 𓂓𓏤 |   |
| 𓂚3 | 𓂚 |  |
| 𓂚3𓍘𓇋4 | 𓂚𓍘𓇋 |  |
| 𓂜1 | 𓂜 |  |
| 𓂜1:𓅪 |  | |
| 𓂝 | 𓂝 |          |
| 𓂝:𓂝:° |  | |
| 𓂝:𓂝:°𓏤 | 𓏤 |  |
| 𓂝:𓂝𓏤 | 𓏤 |  |
| 𓂝:𓂻 |         | |
| 𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥 | 𓏲 |       |
| 𓂝:𓈖 |  | |
| 𓂝:𓈖:° |  | |
| 𓂝:𓈖𓏌𓏲1 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓂝:𓈙𓀞2 | 𓀞 |    |
| 𓂞:𓏏2 |          | |
| 𓂞:𓏏3 |             | |
| 𓂞:𓏏6 |                 | |
| 𓂞:𓏏6𓏲 | 𓏲 |                 |
| 𓂧 | 𓂧 |   |
| 𓂧':𓏭 |               | |
| 𓂧:𓏏*𓏤 |           | |
| 𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 |   |
| 𓂷:𓂡1 |    | |
| 𓂷:𓂡1:° |  | |
| 𓂸:𓏏 |   | |
| 𓂸:𓏏𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 |   |
| 𓂺1 | 𓂺 |  |
| 𓂻 | 𓂻 |              |
| 𓂻1:° | 𓂻 |  |
| 𓂻:° | 𓂻 |                         |
| 𓂼1 | 𓂼 |  |
| 𓂼2 | 𓂼 |  |
| 𓂼2𓂼1 | 𓂼𓂼 |  |
| 𓂽 | 𓂽 |  |
| 𓂽1 | 𓂽 |    |
| 𓂽:° | 𓂽 |  |
| 𓂾𓂾 | 𓂾𓂾 |    |
| 𓃀 | 𓃀 |   |
| 𓃀3𓏲1 | 𓃀𓏲 |      |
| 𓃀4𓏲4 | 𓃀𓏲 |  |
| 𓃀:𓈖1 |                | |
| 𓃀:𓈖1:° |         | |
| 𓃀:𓈖1:°𓊪:𓏭2 |  | |
| 𓃀:𓈖1𓊪:𓏭2 |            | |
| 𓃀𓏲1 | 𓃀𓏲 |          |
| **𓃀𓏲1𓅃𓅆'**:𓎡1 |  | |
| 𓃂 | 𓃂 |    |
| 𓃂𓈘:𓈇 | 𓃂 |    |
| 𓃛 | 𓃛 |     |
| 𓃛𓃛 | 𓃛𓃛 |   |
| 𓃭 | 𓃭 |                                            |
| 𓃭𓏤 | 𓃭𓏤 |                      |
| 𓃹:𓈖 |   | |
| 𓃹:𓈖2 |            | |
| 𓄂:𓏏*𓏤 |          | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1𓄣𓏤 | 𓄣𓏤 |     |
| 𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤 | 𓄣𓏤 |  |
| 𓄋:𓊪1 |   | |
| 𓄋:𓊪@ |  | |
| 𓄑:𓏛1 |                    | |
| 𓄑:𓏛@ |   | |
| 𓄖:𓂻 |     | |
| 𓄛1 | 𓄛 |    |
| 𓄛2 | 𓄛 |  |
| 𓄟1 | 𓄟 |  |
| 𓄡:𓏏*𓏤 |   | |
| 𓄣1𓏤1 | 𓄣𓏤 |  |
| 𓄣𓏤 | 𓄣𓏤 |       |
| 𓄤 | 𓄤 |        |
| 𓄤𓏭:𓏛 | 𓄤 |        |
| 𓄧 | 𓄧 |   |
| 𓄹:𓏭 |                                   | |
| 𓄿 | 𓄿 |      |
| 𓄿1 | 𓄿 |                                                |
| 𓄿:° | 𓄿 |         |
| 𓄿:°𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓄿𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓅃𓅆 | 𓅃𓅆 |     |
| 𓅆 | 𓅆 |                                                                                     |
| 𓅆@ | 𓅆 |      |
| 𓅆@° | 𓅆 |   |
| 𓅆° | 𓅆 |      |
| 𓅐 | 𓅐 |      |
| 𓅐𓏏:𓆇 | 𓅐 |    |
| 𓅐𓏲2𓏏:𓆇 | 𓅐𓏲 |  |
| 𓅓 | 𓅓 |                                                 |
| 𓅓'𓎔 | 𓅓𓎔 |  |
| 𓅓1 | 𓅓 |                                                           |
| 𓅓1𓄿1 | 𓅓𓄿 |  |
| 𓅓1𓅐𓏏:𓆇 | 𓅓𓅐 |  |
| 𓅓1𓈖:𓏥 | 𓅓 |  |
| 𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓅓𓐠𓏤 |                     |
| 𓅓:𓏏 |  | |
| 𓅓:𓏏𓀐 | 𓀐 |  |
| 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 | 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 |  |
| 𓅓𓎔 | 𓅓𓎔 |        |
| 𓅓𓏭 | 𓅓𓏭 |    |
| 𓅓𓏭:𓏛 | 𓅓 |    |
| 𓅓𓏭:𓏛@ | 𓅓 |  |
| 𓅝:𓏏*𓏭 |   | |
| 𓅝:𓏏*𓏭𓅆 | 𓅆 |   |
| 𓅠 | 𓅠 |       |
| 𓅠𓏭:𓏛 | 𓅠 |       |
| 𓅡◳𓏤 |                    | |
| 𓅨:𓂋*𓏰 |    | |
| 𓅪 | 𓅪 |      |
| 𓅪:° | 𓅪 |      |
| 𓅯𓄿 | 𓅯𓄿 |                                                                                                                                       |
| 𓅯𓄿3 | 𓅯𓄿 |  |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓅯𓄿𓇋𓇋 |     |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 | 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 |                        |
| 𓅯𓄿𓏭1 | 𓅯𓄿𓏭 |                                        |
| 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 | 𓅯𓄿𓏲 |   |
| 𓅱 | 𓅱 |     |
| 𓅱𓃀4𓏲4 | 𓅱𓃀𓏲 |  |
| 𓆄 | 𓆄 |  |
| 𓆇:𓏤 |    | |
| 𓆈:𓏥 |    | |
| 𓆊 | 𓆊 |        |
| 𓆎 | 𓆎 |  |
| 𓆎@2 | 𓆎 |               |
| 𓆎@2𓅓1 | 𓆎𓅓 |               |
| 𓆎𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆑 | 𓆑 |                                                                                                        |
| 𓆑1 | 𓆑 |       |
| 𓆑1𓅆 | 𓆑𓅆 |        |
| 𓆑4 | 𓆑 |     |
| 𓆑:𓏭 |   | |
| 𓆓:𓂧 |                                                                                                                                | |
| 𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3 | 𓁷𓏤𓀀 |   |
| 𓆙 | 𓆙 |             |
| 𓆛:𓈖 |    | |
| 𓆣:𓂋𓏲 | 𓏲 |                                                       |
| 𓆤1 | 𓆤 |   |
| 𓆤1:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓆮 | 𓆮 |      |
| 𓆰:𓈖𓏪:° | 𓏪 |       |
| 𓆰𓏪 | 𓆰𓏪 |      |
| 𓆱:𓏏*𓏤 |                      | |
| 𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥:° |   | |
| 𓆱:𓏥:° |   | |
| 𓆳 | 𓆳 |          |
| 𓆳𓏤𓏰:𓇳5 | 𓆳𓏤 |          |
| 𓆷1 | 𓆷 |     |
| 𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳1 | 𓆷𓏰𓏰 |     |
| 𓆸 | 𓆸 |      |
| 𓆼 | 𓆼 |               |
| 𓆼1 | 𓆼 |        |
| 𓆼𓄿3 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿3𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿5 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿5𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓇇 | 𓇇 |  |
| 𓇋1 | 𓇋 |       |
| 𓇋1𓇋𓀀 | 𓇋𓇋𓀀 |  |
| 𓇋1𓏏:𓆑 | 𓇋 |    |
| 𓇋2 | 𓇋 |            |
| 𓇋2𓆛:𓈖 | 𓇋 |    |
| 𓇋5 | 𓇋 |         |
| 𓇋5:𓎡 |         | |
| 𓇋𓀁 | 𓇋𓀁 |            |
| 𓇋𓀁1 | 𓇋𓀁 |                                   |
| 𓇋𓀁1𓋴𓏏 | 𓇋𓀁𓋴𓏏 |   |
| 𓇋𓀁𓂋:𓎡 | 𓇋𓀁 |  |
| 𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤 | 𓇋𓀁 |           |
| 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛 | 𓇋𓀁𓏤𓏛 |       |
| 𓇋𓂋:𓏭 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓂋:𓏭𓀹1 | 𓇋𓀹 |  |
| 𓇋𓇋 | 𓇋𓇋 |           |
| 𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓇋𓇋 |          |
| 𓇋𓇋𓆑 | 𓇋𓇋𓆑 |    |
| 𓇋𓇋𓏲 | 𓇋𓇋𓏲 |                                                                                                                  |
| 𓇋𓈖 | 𓇋𓈖 |   |
| 𓇋𓋴𓏏 | 𓇋𓋴𓏏 |                        |
| 𓇋𓎛𓃒 | 𓇋𓎛𓃒 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖 | 𓇋 |     |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆 | 𓇋𓅆 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆° | 𓇋𓅆 |  |
| 𓇋𓏲 | 𓇋𓏲 |                                                                                                                   |
| 𓇋𓏲 𓏪3 | 𓇋𓏲 𓏪 |  |
| 𓇋𓏲𓆑 | 𓇋𓏲𓆑 |              |
| 𓇋𓏲𓏪 | 𓇋𓏲𓏪 |   |
| 𓇍1𓇋1 | 𓇍𓇋 |            |
| 𓇍1𓇋1𓂻 | 𓇍𓇋𓂻 |            |
| 𓇏:° | 𓇏 |  |
| 𓇓1 | 𓇓 |                   |
| 𓇓1𓅆 | 𓇓𓅆 |          |
| 𓇘 | 𓇘 |   |
| 𓇘:𓏏*𓏰𓅓 | 𓅓 |   |
| 𓇛1 | 𓇛 |   |
| 𓇣𓂧:𓏏*𓏰𓌽:𓏥1 | 𓇣 |   |
| 𓇥:𓂋1 |       | |
| 𓇥:𓂋1𓏭:𓏛 |   | |
| 𓇥:𓂋1𓏲𓏭:𓏛 | 𓏲 |  |
| 𓇥:𓂋2 |  | |
| 𓇥:𓂋2𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇯 | 𓇯 |                                             |
| 𓇳 | 𓇳 |                            |
| 𓇳𓅆 | 𓇳𓅆 |      |
| 𓇳𓍼:𓏤 | 𓇳 |     |
| 𓇳𓍼:𓏤° | 𓇳 |  |
| 𓇹 | 𓇹 |   |
| 𓇹:𓇼 |   | |
| 𓇹:𓇼:𓇳 |   | |
| 𓇺:𓏺 |  | |
| 𓇺:𓏺1 |  | |
| 𓇺:𓏻1 |     | |
| 𓇺:𓏼@ |        | |
| 𓇺:𓏽@ |   | |
| 𓇾:𓏤@ |   | |
| 𓇾:𓏤𓈇@ | 𓈇 |   |
| 𓈉2 | 𓈉 |        |
| 𓈉2:𓏏*𓏤 |        | |
| 𓈌 | 𓈌 |   |
| 𓈌:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓈍:𓂝*𓏛 |      | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆 | 𓅆 |    |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆° | 𓅆 |  |
| 𓈎 | 𓈎 |               |
| 𓈎:° | 𓈎 |  |
| 𓈎:𓈖 |     | |
| 𓈎:𓈖@ |  | |
| 𓈎:𓈖𓏌𓏲1 | 𓏌𓏲 |   |
| 𓈐':𓏏*𓏤 |  | |
| 𓈐:𓂻 |    | |
| 𓈐:𓂻@ |  | |
| 𓈒 | 𓈒 |  |
| 𓈒:𓏥 |  | |
| 𓈔 | 𓈔 |   |
| 𓈖 | 𓈖 |                                                               |
| 𓈖1 | 𓈖 |                 |
| 𓈖1:**𓇛1𓅓1** |   | |
| 𓈖2 | 𓈖 |                            |
| 𓈖2:𓌳° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖 |         | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁 | 𓀁 |  |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁 | 𓀁 |        |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁° | 𓀁 |  |
| 𓈖:𓄿 |                                                                                          | |
| 𓈖:𓄿° |                | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋 | 𓇋𓇋 |      |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓇋𓇋 |  |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑 | 𓇋𓇋𓆑 |  |
| 𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4 | 𓇋𓇋𓆑 |       |
| 𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥 | 𓏲 |   |
| 𓈖:𓈖9 |   | |
| 𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 |      | |
| 𓈖:𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖:**𓋴𓆰:𓈖𓏪:°** |       | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲 |       | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1 |     | |
| 𓈖:𓎡2 |  | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 |    | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 |    | |
| 𓈖:𓏌*𓏲 |             | |
| 𓈖:𓏏 |  | |
| 𓈖:𓏏*𓏭1 |                                                                          | |
| 𓈖:𓏥 |      | |
| 𓈖:𓏲*𓏥 |    | |
| 𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 | 𓈖𓇋𓅓 |                      |
| 𓈗 | 𓈗 |         |
| 𓈗𓈘:𓈇 | 𓈗 |         |
| 𓈘:𓈇 |             | |
| 𓈙 | 𓈙 |                 |
| 𓈝 | 𓈝 |          |
| 𓈝𓂻:° | 𓈝𓂻 |          |
| 𓉐:𓉻 |                  | |
| 𓉐:𓉻𓅆 |                  | |
| 𓉐𓏤 | 𓉐𓏤 |                            |
| 𓉐𓏤1 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@1 | 𓉐𓏤 |                            |
| 𓉐𓏤@2 | 𓉐𓏤 |    |
| 𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |            |
| 𓉔 | 𓉔 |                          |
| 𓉔1 | 𓉔 |    |
| 𓉗1 | 𓉗 |                       |
| 𓉗1𓉐𓏤@1 | 𓉗𓉐𓏤 |                 |
| 𓉞 | 𓉞 |   |
| 𓉺1 | 𓉺 |  |
| 𓉺1:𓏏*𓏰𓏌 |  | |
| 𓉻 | 𓉻 |    |
| 𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 |    | |
| 𓉻:𓂝*𓏛 |                                               | |
| 𓉿:𓂡1 |            | |
| 𓊃 | 𓊃 |      |
| 𓊃:𓀀:𓈖 |   | |
| 𓊃:𓈞𓁐2 |  | |
| 𓊌1 | 𓊌 |         |
| 𓊏 | 𓊏 |      |
| 𓊏𓏭:𓏛 | 𓊏 |      |
| 𓊑1 | 𓊑 |     |
| 𓊖 | 𓊖 |  |
| 𓊗:𓏻1 |   | |
| 𓊡 | 𓊡 |   |
| 𓊡𓏭:𓏛 | 𓊡 |  |
| 𓊡𓏲𓏭:𓏛 | 𓊡𓏲 |  |
| 𓊢𓂝:𓂻 | 𓊢 |    |
| 𓊤 | 𓊤 |  |
| 𓊤𓏲 | 𓊤𓏲 |  |
| 𓊨 | 𓊨 |    |
| 𓊨:° | 𓊨 |   |
| 𓊨:°𓏤𓉐𓏤 | 𓊨𓏤𓉐𓏤 |  |
| 𓊨𓏏:𓆇1 | 𓊨 |    |
| 𓊪 | 𓊪 |         |
| 𓊪1 | 𓊪 |              |
| 𓊪1:° | 𓊪 |     |
| 𓊪1:𓉐𓏤1 |   | |
| 𓊪:° | 𓊪 |    |
| 𓊪:𓏏𓎛 |    | |
| 𓊪:𓏏𓎛𓅆 |    | |
| 𓊪:𓏭 |       | |
| 𓊪:𓏭2 |             | |
| 𓊮 | 𓊮 |  |
| 𓊵:𓏏@1 |  | |
| 𓊹 | 𓊹 |       |
| 𓊹𓅆 | 𓊹𓅆 |  |
| 𓊹𓅆° | 𓊹𓅆 |   |
| 𓊹𓊹𓊹1 | 𓊹𓊹𓊹 |      |
| 𓊹𓍛𓏤:𓀀 | 𓊹𓍛 |   |
| 𓊽 | 𓊽 |   |
| 𓊽1 | 𓊽 |   |
| 𓊽1𓊽1 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓊽𓊽 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓋀 | 𓋀 |     |
| 𓋀𓏤 | 𓋀𓏤 |    |
| 𓋀𓏤𓏰:𓊖3 | 𓋀𓏤 |  |
| 𓋁𓃀1 | 𓋁𓃀 |  |
| 𓋁𓃀1𓏤𓊖 | 𓋁𓃀𓏤𓊖 |  |
| 𓋞:𓈒*𓏥1 |   | |
| 𓋩1 | 𓋩 |   |
| 𓋩2 | 𓋩 |  |
| 𓋴 | 𓋴 |                                            |
| 𓋴@𓏤 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴@𓏤𓄹:𓏭 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴𓏏 | 𓋴𓏏 |                                        |
| 𓋴𓏏1𓏏 | 𓋴𓏏𓏏 |   |
| 𓋹𓈖:𓐍 | 𓋹 |         |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |          |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏2 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |                       |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏4 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |      |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰 | 𓌃 |   |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁 | 𓌃 |   |
| 𓌉 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥1 | 𓌉 |  |
| 𓌗1 | 𓌗 |     |
| 𓌗2 | 𓌗 |  |
| 𓌙:𓈉 |                   | |
| 𓌙:𓈉1 |    | |
| 𓌢° | 𓌢 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌨:𓂋𓏭:𓏛 |     | |
| 𓌪:𓂡 |      | |
| 𓌳° | 𓌳 |  |
| 𓌶:𓂝2 |  | |
| 𓌶:𓂝2𓆄 |  | |
| 𓌻 | 𓌻 |     |
| 𓌻𓀁 | 𓌻𓀁 |  |
| 𓌻𓏭:𓏛1𓀁 | 𓌻 |    |
| 𓍃 | 𓍃 |    |
| 𓍃𓅓𓏭:𓏛 | 𓍃𓅓 |    |
| 𓍊𓏤 | 𓍊𓏤 |    |
| 𓍑 | 𓍑 |                 |
| 𓍑𓄿3 | 𓍑𓄿 |     |
| 𓍑𓍑 | 𓍑𓍑 |     |
| 𓍘 | 𓍘 |  |
| 𓍘1 | 𓍘 |            |
| 𓍘1𓎟:𓏏1 | 𓍘 |        |
| 𓍘𓇋2 | 𓍘𓇋 |    |
| 𓍘𓇋4 | 𓍘𓇋 |   |
| 𓍘𓈖:𓏏 | 𓍘 |  |
| 𓍘𓈖:𓏏1 | 𓍘 |  |
| 𓍯 | 𓍯 |                            |
| 𓍱 | 𓍱 |    |
| 𓍱1 | 𓍱 |  |
| 𓍱:𓂡1 |  | |
| 𓍱:𓂡1𓏏 |  | |
| 𓍴 | 𓍴 |       |
| 𓍴𓈖:𓈖9 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |       |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2 | 𓍴 |    |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓋩2 | 𓍴 |  |
| 𓍸𓏛1 | 𓍸𓏛 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |                                |
| 𓍺 | 𓍺 |                            |
| 𓍼:𓏤1 |   | |
| 𓍼:𓏥 |  | |
| 𓎃° | 𓎃 |    |
| 𓎆 | 𓎆 |            |
| 𓎔 | 𓎔 |  |
| 𓎔2 | 𓎔 |                |
| 𓎔2: | 𓎔: |          |
| 𓎔:𓏺 |   | |
| 𓎔:𓏻 |      | |
| 𓎔:𓏼 |      | |
| 𓎔:𓏽 |    | |
| 𓎛 | 𓎛 |     |
| 𓎛1 | 𓎛 |  |
| 𓎛2 | 𓎛 |        |
| 𓎛2𓐑:𓊪𓏲1 | 𓎛 |        |
| 𓎛𓂝:𓏏𓄹 | 𓎛 |   |
| 𓎝𓎛 | 𓎝𓎛 |  |
| 𓎟:𓏏 |        | |
| 𓎟:𓏏1 |  | |
| 𓎡 | 𓎡 |                  |
| 𓎡1 | 𓎡 |          |
| 𓎡1:𓇋1𓇋𓀀 |  | |
| 𓎡:𓍘𓇋 |   | |
| 𓎨 | 𓎨 |   |
| 𓎭 | 𓎭 |    |
| 𓎱1 | 𓎱 |    |
| 𓎱1:𓇳 |    | |
| 𓎸 | 𓎸 |   |
| 𓎸1 | 𓎸 |  |
| 𓎸𓅓𓏰:𓇳1 | 𓎸𓅓 |   |
| 𓎼 | 𓎼 |             |
| 𓏇1 | 𓏇 |   |
| 𓏇1𓇋1 | 𓏇𓇋 |   |
| 𓏌 | 𓏌 |      |
| 𓏌:𓈖 |     | |
| 𓏌:𓈖:° |     | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤 |    | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤@1 |  | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤 |   | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤@1 |   | |
| 𓏌𓏲1 | 𓏌𓏲 |          |
| 𓏌𓏲2 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏌𓏲𓍖:𓏛 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏎:𓈖 |   | |
| 𓏏 | 𓏏 |                                                                    |
| 𓏏*𓏤 | 𓏏𓏤 |        |
| 𓏏*𓏰 | 𓏏𓏰 |        |
| 𓏏1 | 𓏏 |            |
| 𓏏1:° | 𓏏 |  |
| 𓏏:° | 𓏏 |   |
| 𓏏:𓄿 |                                                                | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |     | |
| 𓏏:𓄿𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑 |    | |
| 𓏏:𓄿𓏭 |        | |
| 𓏏:𓆇 |         | |
| 𓏏:𓆇1 |   | |
| 𓏏:𓆑 |    | |
| 𓏏:𓈇𓏤@1 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥:° |    | |
| 𓏛 | 𓏛 |    |
| 𓏛𓏏 | 𓏛𓏏 |  |
| 𓏞𓍼:𓏤 | 𓏞 |  |
| 𓏠:𓈖 |        | |
| 𓏠:𓈖1 |   | |
| 𓏠:𓈖1:° |   | |
| 𓏠:𓈖1:°𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |   | |
| 𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛 |  | |
| 𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |  | |
| 𓏤 | 𓏤 |                                  |
| 𓏤1𓈘:𓈇 | 𓏤 |  |
| 𓏤𓊖 | 𓏤𓊖 |   |
| 𓏤𓏰:𓇳5 | 𓏤 |          |
| 𓏤𓏰:𓊖1 | 𓏤 |  |
| 𓏤𓏰:𓊖3 | 𓏤 |                      |
| 𓏥 | 𓏥 |    |
| 𓏪 | 𓏪 |                                                                                                                     |
| 𓏪1 | 𓏪 |                   |
| 𓏪1° | 𓏪 |   |
| 𓏪3 | 𓏪 |                                     |
| 𓏫 | 𓏫 |   |
| 𓏫1:° | 𓏫 |   |
| 𓏫:° | 𓏫 |   |
| 𓏭:𓂢 |    | |
| 𓏭:𓏛 |                                               | |
| 𓏭:𓏛1 |              | |
| 𓏰:𓀀 |  | |
| 𓏰:𓇳1 |                | |
| 𓏰:𓇳1@ |           | |
| 𓏰:𓇳2𓏤2 |      | |
| 𓏰:𓊖2° |    | |
| 𓏲 | 𓏲 |                  |
| 𓏲1 | 𓏲 |       |
| 𓏲2 | 𓏲 |   |
| 𓏲:𓏏 |              | |
| 𓏲:𓏏𓏤 |     | |
| 𓏲𓏭:𓏛 | 𓏲 |                              |
| 𓏴:𓂡 |           | |
| 𓏴:𓂡𓍘1 |         | |
| 𓏴:𓏛4 |   | |
| 𓏴:𓏛4𓀁 |   | |
| 𓏶 | 𓏶 |     |
| 𓏶𓅓 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓𓏭 | 𓏶𓅓𓏭 |    |
| 𓏺 | 𓏺 |      |
| 𓏺:𓏏 |    | |
| 𓏻4 | 𓏻 |  |
| 𓏻:𓏌 |   | |
| 𓏼1 | 𓏼 |        |
| 𓏾 | 𓏾 |      |
| 𓏿 | 𓏿 |        |
| 𓐀 | 𓐀 |    |
| 𓐀1 | 𓐀 |  |
| 𓐁 | 𓐁 |    |
| 𓐁1 | 𓐁 |   |
| 𓐁1:𓐋2𓏌𓏲1𓀼 |   | |
| 𓐂 | 𓐂 |   |
| 𓐅 | 𓐅 |  |
| 𓐆 | 𓐆 |  |
| 𓐇 | 𓐇 |  |
| 𓐈1 | 𓐈 |  |
| 𓐉 | 𓐉 |  |
| 𓐊 | 𓐊 |   |
| 𓐋2 | 𓐋 |   |
| 𓐍 | 𓐍 |         |
| 𓐍:𓂋 |    | |
| 𓐍:𓂋𓀁 |    | |
| 𓐍:𓅓 |     | |
| 𓐍:𓅓𓅪 |  | |
| 𓐍:𓅓𓅪:° |    | |
| 𓐍:𓊪2 |   | |
| 𓐍:𓏏*𓏰 |    | |
| 𓐍:𓏭 |     | |
| 𓐑:𓊪 |       | |
| 𓐑:𓊪𓏲1 |  | |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛 | 𓐠𓏤 |      |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓐠𓏤 |                    |
| 𓐪 | 𓐪 |    |
| 𓐪𓂧:𓏏*𓏰 | 𓐪 |  |
| | |  |
| ⸗y "[Suffixpron. 1. sg. c.]" |             |
| ⸗w; [⸗w]; ⸢⸗w⸣ "[Suffixpron. 3. pl. c.]" |                                                                                            |
| ⸗f; [⸗f]; ⸢⸗f⸣ "[Suffixpron. 3. sg. m.]" |                                                                                                   |
| ⸗n "[Suffixpron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸗s "[Suffixpron. 3. sg. f.]" |                          |
| ⸗k "[Suffixpron. 2. sg. m.]" | 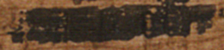       |
| ⸗tn "[Suffixpron. 2. pl. c.]" |    |
| ꜣwy "Lobpreis" |  |
| ꜣbḫ "vergessen" |  |
| ꜣbd "Monat" |   |
| ꜣbd-1 "Monat 1" |   |
| ꜣbd-2 "Monat 2" |     |
| ꜣbd-3; ⸢ꜣbd-3⸣ "Monat 3" |        |
| ꜣbd-4 "Monat 4" |   |
| ꜣbdy "Neulicht, zweiter Tag des Mondmonats" |   |
| ꜣfꜥ(.t); ꜣfꜥ(.w) "gierig [Adjektiv]" |   |
| ꜣrwy "Stengel, Stoppel, Spreu" |   |
| ꜣḥ.w "Acker" |  |
| ꜣḫ(.t) "Überschwemmungsjahreszeit, Achet" |     |
| ꜣs(.t) "Isis [GN]" |   |
| ꜣsḳ "zögern" | 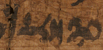 |
| ꜣgy "tüchtig, vorzüglich, vortrefflich" | 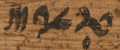 |
| ꜣḏꜣ(.t) "Hacke" | 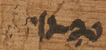 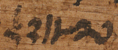 |
| ỉ.ỉr-ḥr "vor, bei, zur Zeit von [Präp.]" |  |
| ỉ.ḳd "Baumeister" |  |
| ỉꜣw.t "Amt, Würde" |    |
| ỉꜣw.t-(n)-ḥrỉ "Herrscheramt" |    |
| ỉꜣb.tỉ "Osten" |  |
| ỉ:ỉri̯ "[Konverter 2. Tempus]" |      |
| ỉ:ỉri̯; (ỉ:)ỉri̯ "[Bildungselement des Partizips]" |                |
| ỉ:ỉri̯⸗f "[Konverter 2. Tempus + Suffixpron. 3. sg. m.]" | 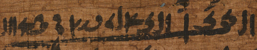   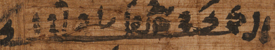      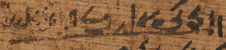 |
| ỉyi̯ "kommen" |           |
| ỉꜥḥ "Mond" |  |
| ỉw; [ỉw] "[Bildungselement des Futur III]" |                                                 |
| ⸢ỉw⸗w⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. pl. c.]" |   |
| ỉw⸗f "er [proklit. Pron. 3. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗f "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗f "indem er [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗s "sie [proklit. Pron. 3. sg. f.]" |      |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. f.]" |       |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣; ⸢ỉw⸣⸗s "indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. f.]" |           |
| ỉw⸗k "du [proklit. Pron. 2. sg. m.]" |   |
| ỉw⸗k "indem du [Umstandskonverter + Suffixpron. 2. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗k "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉw⸗k "[Konditionalis + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉwi̯ "kommen" |  |
| ỉwỉw.w; ỉwỉw "Hund" |   |
| Ỉwnw "Heliopolis [ON])" | 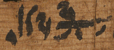 |
| ỉwr "schwanger werden" |  |
| ỉb "Herz" |  |
| ỉbỉ "Honig" |   |
| ỉp "zählen" |   |
| ỉpe.t; ỉpe(.t) "Arbeit" |    |
| ỉpre "Sproß, Samen, Korn" |  |
| ỉmn "Amun [GN]" |   |
| ỉmn.tỉ "Westen" |  |
| Ỉmn-ỉ:ỉri̯-ḏi̯.t-s "Amyrtaios [KN]" | 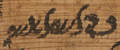  |
| ỉn "[Fragepartikel]" |  |
| ỉn "[Postnegation]" |  |
| ỉni̯ "holen, bringen" |   |
| ỉne "Stein" |    |
| ỉr.t "Auge" |   |
| ỉrỉ "Gefährte" |  |
| ỉri̯; {ỉri̯}; ỉri̯ (?); ỉ:ỉri̯ "tun, machen" |                                       |
| ỉri̯⸗f "[Verb + Suffixpron. 3. sg. masc.]" |      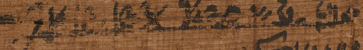   |
| ỉri̯-ḥrỉ "Herrschaft, Regierung" |        |
| ỉri̯-sh̭y "Macht haben über, verfügen über" |  |
| ỉrpy; ỉrp⸢y⸣.w; ỉrpy.w "Tempel" |    |
| ỉrm "mit, und [Präp.]" |       |
| ỉrm pꜣ ḫpr ꜥn "und ferner" | 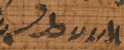 |
| ỉḥ.t "Kuh" |  |
| ỉṱ "Vater" |    |
| yꜥr "Fluß, Kanal" | 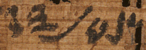 |
| yꜥr-ꜥꜣ "'großer Fluß', Nil" | 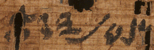 |
| Ybyꜣ "Elephantine [ON]" | 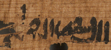 |
| [ꜥ].wỉ; ꜥwỉ.w "Haus, Platz" |   |
| ꜥꜣ "Art, Zustand" |  |
| ꜥꜣ; ꜥy.w "groß [Adjektiv]" |     |
| ꜥw; ꜥꜣ; ꜥy "groß sein [Adjektivverb]" |     |
| ꜥw-n-ỉr.t "Glück" |  |
| ꜥby.t "Spende, Opfer" | 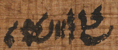 |
| ꜥn "erneut, wieder [Adverb]" |      |
| ꜥnḫ "leben" |     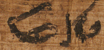  |
| ꜥnḫ "Leben" |  |
| ꜥrꜥy(.t); ꜥry(.t) "Uräusschlange" |        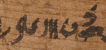 |
| ꜥrwy "vielleicht [Adv.]" | 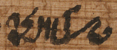 |
| ꜥrḳy "letzter Monatstag" |      |
| ꜥrḏ "Sicherheit, Festigkeit" |  |
| ꜥḥꜥ "stehen" |    |
| ꜥš "rufen" |    |
| ꜥš-šlly "flehen" |  |
| ꜥšꜣ "zahlreich sein [Adjektivverb]" |   |
| ꜥšꜣ "zahlreich [Adjektiv]" |  |
| ꜥḳ "Brot, Ration" |     |
| wꜣḥ-sḥn "befehlen" |  |
| wyꜥ "Bauer" | 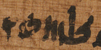 |
| Wynn.w; Wynn(.w) "Grieche" |   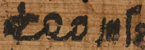 |
| wꜥ.t "eine" |    |
| wꜥb.w "rein sein, unbelastet sein" |   |
| wꜥb.t "Balsamierung, Tod" |  |
| wn "öffnen" |            |
| wn "sein, existieren" |   |
| wnm "rechts, rechte Seite" |    |
| wnm "essen" |     |
| wnty.w "Kurzhornrind, Opfertier " |  |
| wr<š>e "Altlicht; Mondmonat" |   |
| whꜥ "böse Tat, Sünde, Verfehlung" |  |
| bỉk.w "Falke" |  |
| bw-ỉri̯ "[Negation des Aorists]" |   |
| bn "[Negation]" |  |
| bn.ỉw "[Negation Futur III]" |     |
| bn.ỉw "[Negation Präsens I]" |  |
| bn-p "[Negation Vergangenheit]" |             |
| blꜣ "lösen" |  |
| bš "entblößen, verlassen, reduzieren" |  |
| bgs "sich empören, rebellieren" |  |
| btw "Strafe" | 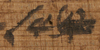   |
| bd(.t) "Emmer" |   |
| p.t; p(.t) "Himmel" |   |
| pꜣ "der [def. Art. sg. m.]" |                                                                                                                          |
| pꜣ tꜣ (n) ẖr "Syrerland, Syrien [ON]" |   |
| pꜣ-bnr-n; pꜣ-bnr-(n) "außer, außerhalb [Präp.]" |   |
| pꜣ-hrw "heute, jetzt [Adverb]" |     |
| Pꜣ-šrỉ-Mw.t "Psammuthis [KN]" |  |
| pꜣỉ "[def. Art. sg. m. + Präfix der Relativform]" |   |
| pꜣỉ "dieser [Demonstrat. sg. m.]" |  |
| pꜣỉ; ⸢pꜣỉ⸣ "[Kopula sg. m.]" |                                     |
| pꜣy⸗w "ihr" |   |
| pꜣy⸗f "sein" |                      |
| pꜣy⸗k "dein" |  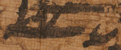   |
| ⸢pa⸣; pa "der von" |       |
| Py "Pe, Buto [ON]" | 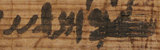  |
| py "Thron" |  |
| pr.w "Haus" |  |
| pr(.t) "Aussaat-Zeit, Peret, Winter" |       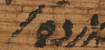     |
| pr-ꜥꜣ "König" |             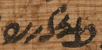    |
| pr-pr-ꜥꜣ "Königspalast" |  |
| Pr-nb(.t)-ṱp-ỉḥ "Aphroditopolis, Atfih [ON]" | 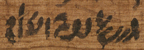 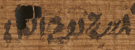 |
| pri̯ "herauskommen" |  |
| prḏꜣ "Kinn(?)" | 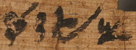 |
| pḥ "erreichen, ankommen" |     |
| pẖrꜣ "herumgehen, durchziehen" | 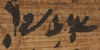 |
| pẖry.w(t) "Medikament, Zaubermittel" |  |
| Ptḥ "Ptah [GN]" |    |
| m-sꜣ; m-sꜣ⸗ "hinter [Präp.]" |                     |
| m-ḳdy; ⸢m⸣-ḳdy; m-ḳde "in der Art von [Präp.]" |    |
| m-tw⸗ "bei, jemanden gehören [Präp.]" |     |
| m-tw⸗ "durch [Präp.]" |  |
| m-ḏr "bei, durch [Präp.]" |   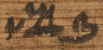   |
| mꜣỉ.w(t) "Insel" |  |
| mꜣꜥ.w "Ort, Platz" |  |
| mꜣḫe.t; mꜣḫe(.t) "Waage" |   |
| mỉ(.t); mỉ.t "Straße" |  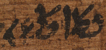 |
| my "[enklitische Partikel nach dem Imperativ]" |  |
| my "[Imperativ von ḏi̯.t]" |    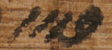 |
| myt "Weg, Rechtsanspruch" |  |
| mꜥḏy "Profit" | 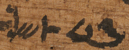  |
| mw "Wasser" |    |
| Mw(.t) "Mut [GN]" |     |
| ⸢mwt⸣ "sterben" |  |
| mn; bn.ỉw "es gibt nicht [Negation der Existenz]" |      |
| [Mn]-nfr; Mn-nfr "Memphis [ON]" |    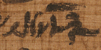 |
| mnḫ "tugendhaft, wohltätig sein [Adjektivverb]" | 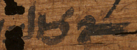   |
| mnḳ "Vollendung" |    |
| mnḳ "vollenden" |  |
| mr.t "Liebe, Beliebtheit, Wunsch, Wille" |  |
| mri̯; mri̯.ṱ⸗ "lieben, wünschen" |    |
| mlẖ "Streit" |  |
| mḥ "füllen" |         |
| mḥ-10.t "zehntes" |  |
| mḥ-11 "elftes" |  |
| mḥ-12 "zwölftes" |  |
| mḥ-13 "dreizehntes" |  |
| [mḥ-14] "vierzehntes" | |
| mḥ-2 "zweiter" |      |
| mḥ-3 "dritter" |      |
| mḥ-4 "vierter" |    |
| mḥ-5 "fünfter" |    |
| mḥ-6 "sechster" |    |
| mḥ-7.t; mḥ-7 "siebtes" |    |
| mḥ-8.t "achtes" |  |
| mḥ-9.t "neuntes" | 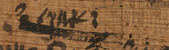 |
| mh̭y "gleichen, vergleichen" |  |
| ms.t "Geburt" | 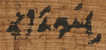 |
| msḥ.w "Krokodil" | 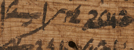 |
| mšꜥ "Armee, Volksgruppe, Menge" |  |
| mšꜥ "gehen, marschieren" |   |
| mtỉ "Flut, Wasser" | 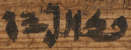 |
| mtw "[Bildungselement des Konjunktivs]" |  |
| mtw⸗s "[selbst. Pron. 3. Sg. f.]" |  |
| mtr "Zeuge sein, zugegen sein" |  |
| md.w(t) "Rede, Wort, Sache, Angelegenheit" |   |
| Mdy.w; Mdy⸢.w⸣; Mdy(.w) "Meder, Perser" | 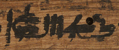 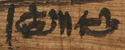          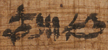 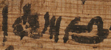  |
| n; ⸢n⸣ "des [Genitiv]" |                |
| n; n.ỉm⸗ "in (< m) [Präp.]" |                                                         |
| n; n⸗ "zu, für (< n; Dativ)" |                     |
| n.ỉm "dort [Adverb]" |   |
| n.n⸗w "für sie" |     |
| n⸗k "für dich" |  |
| (n)-rn; (n)-rn⸗; ⸢(n)-rn⸣ "besagter, betreffender" |       |
| n-ḏr(.t) "als, nachdem [Temporalis]" |        |
| nꜣ; ⸢nꜣ⸣ "die [def. Art. pl. c.]" |                                                                                |
| nꜣ.w "[def. Art. pl. c. + Präfix der Relativform]" |      |
| nꜣ.w "für mich" |  |
| nꜣ.w "[Kopula Plural]" |       |
| nꜣ-ꜥn; ꜥn "schön sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣ-nḏm; nḏm "angenehm sein, froh sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| nꜣy⸗w "ihre" |   |
| nꜣy⸗f "seine" |     |
| Nꜣy⸗f-ꜥw-rd.wỉ "Nepherites [KN]" |  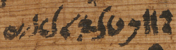 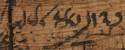 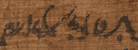  |
| nꜣy⸗n "unsere" |   |
| nꜣy⸗s "ihre" |  |
| nꜣy⸗k "deine" |  |
| nw "sehen" |     |
| nwḥ "Strick" |   |
| nb "Gold" |   |
| nb; nb.w "Herr" |    |
| nb.t "Frevel, Sünde" |  |
| nb(.t); nb.t "Herrin" |   |
| nb-n-ḫꜥi̯ "Herr der Erscheinungen" |  |
| nfr "gut sein [Adjektivverb]" |   |
| nfr "gut [Adjektiv]" |  |
| nmꜣy(.t)(?) "'Wanderin' (?)" |   |
| nhe(.t) "Sykomore" |  |
| nḫ(?)(.t) "Klage, Totenklage" | 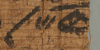 |
| nḫby(.t) "Königstitulatur" | 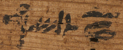 |
| Nḫṱ-nb⸗f "Nektanebos I. [KN]" |  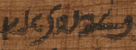 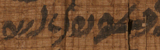 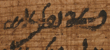     |
| nsw "König" |  |
| nkt "Sache" |    |
| nkt-ḥwrꜥ "Raubgut" |  |
| ntỉ "[Relativkonverter]" |                                                       |
| ntỉ.ỉw "[Relativkonverter]" |                 |
| ntỉ.ỉw⸗f "[Relativkonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |  |
| ntỉ.ỉw⸗k "[Relativkonverter + Suffixpron. 2 sg. m.]" |  |
| ntỉ-ỉri̯ "[Relativkonverter + r im Futur III vor nominalem Subjekt]" |  |
| nṯr "Gott" |    |
| nṯr.w "Götter" |      |
| r "[im Futur III vor nominalem Subjekt]" |       |
| r "[im Futur III vor Infinitiv]" |            |
| r "macht (bei Beträgen u.ä.)" |    |
| r; ỉw; ⸢ỉw⸣ "indem, wobei [Umstandskonverter]" |               |
| r; [r]; r.ḥr⸗ "zu, hin [Präp.]" |                                    |
| r.r⸗w "zu ihnen" |     |
| r.r⸗k "zu dir" |   |
| r-wbꜣ "gegen, gegenüber, vor [Präp.]" |  |
| r-bnr "heraus [Adverb]" |  |
| r-ḥr "auf, vor [Präp.]" |  |
| r-ẖ(.t) "in der Art von, entsprechend [Präp.]" |   |
| (r)-ḏbꜣ; (r)-ḏbꜣ⸗ "wegen [Präp.]" | 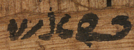   |
| Rꜥ "Re [GN]" |      |
| rmy "weinen, beweinen" | 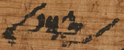  |
| rmy(.t) "Träne" |  |
| rmṯ; rmṯ.w "Mensch, Mann" |         |
| rmṯ-(n)-ḳnḳn "Krieger" |  |
| rn "Name" |    |
| rnp(.t); rnp.w(t) "Jahr" |          |
| rḫ; ỉr.rḫ "wissen, können" |   |
| rše; ršy "sich freuen" | 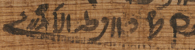  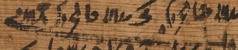  |
| ršy "Freude" |  |
| (r:)ḳd "bauen" |  |
| rd.wỉ "Fuß" |  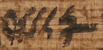  |
| lk "aufhören, beseitigen" |        |
| <mḥ-1>; mḥ-1 "erster" |   |
| <3.nw> "dritter" | |
| hꜣ; ⸢h⸣[ꜣ] "Zeit" |           |
| ⸢hp⸣; hp "Recht, Gesetz, Gesetzanspruch" |        |
| hri̯.w "zufrieden sein, besänftigt sein" |  |
| Hgr; Hḳr "Hakoris [KN]" |  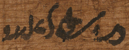 |
| htmꜣ "Thron" |  |
| ḥꜣ(.t) "vor [Präp.]" |   |
| ḥꜣ.t; ḥꜣ(.t) "Vorderteil, Anfang, Spitze" |     |
| ḥꜣ.tỉ; ḥꜣ.tỉ⸗ "Herz" |      |
| ḥꜣṱ; ḥꜣṱ.t "erster, früherer [Adjektiv]" |   |
| ḥꜥ⸗ "selbst" |   |
| ḥw.ṱ "Ackerbauer" |  |
| Ḥw.t-nn-nsw; Ḥw.t-(nn)-nsw "Herakleopolis [ON]" |    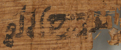   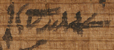   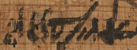 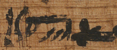 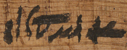 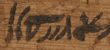  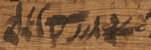  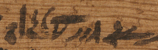 |
| ḥwe(.t); ḥwe.t; ⸢ḥwe⸣[.t] "Kapitel, Strophe" |         |
| ḥwy "Regen" |   |
| ḥwy "schlagen, werfen" |  |
| ḥwrꜥ "rauben, berauben" |   |
| ḥwrꜥ; ḥwrꜥ(.w) "Raub, Räuberei" |    |
| ḥwṱ "Mann, männlich" |  |
| ḥbs "bekleiden, bedecken" | 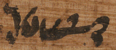 |
| ḥbs.w "Kleidung" |  |
| Ḥp "Apisstier [GN]" |        |
| ḥm.t "Frau, Ehefrau" |  |
| ḥm-nṯr "Gottesdiener, Prophet" |   |
| ḥmꜣ.t "Gebärmutter" |   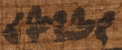 |
| ḥn "befehlen" |   |
| ḥr "auf [Präp.]" |          |
| ḥr-ꜣt⸗ "auf [Präp.]" | 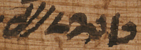 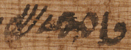 |
| Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) "Horus, Sohn der Isis [GN]" |    |
| Ḥr-šf "Herischef [GN]" |      |
| ḥrỉ "oben [Adverb]" |    |
| ḥrỉ "Oberster, Herr, Vorgesetzter" |                                          |
| ḥrḥ "wachen, hüten" |  |
| ḥlly; ḥll "Trübung, Finsternis (?)" | 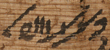  |
| ḥḳr; ḥḳꜣ "hungern" |     |
| ḥtp-nṯr "Gottesopfer" |  |
| ḥḏ "Silber, Geld" |  |
| ḥḏ.t "Weiße Krone" |  |
| ḫꜣ "Meßstab" |   |
| ḫꜣꜥ "werfen, legen, lassen, verlassen" |         |
| ḫꜣsy(.t); ḫꜣs.w(t); ḫꜣs(.wt) "Fremdland, Wüste, Nekropole" |        |
| h̭yh̭e "Staub" |  |
| ḫꜥ "Fest" |  |
| ḫꜥi̯ "erscheinen" |     |
| ḫby "vermindern, abschneiden, rasieren" |  |
| ḫpr "geschehen" |                                                |
| ḫpr "es ist so (dass), denn, weil [Konjunktion]" |        |
| ḫpš; ḫbš "Sichelschwert" |    |
| ḫm.w "klein, jung [Adjektiv]" |  |
| ḫm-ẖr.w; ḫm-ẖr(.w) "Knabe, junger Mensch, Bursche, Kind" | 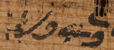 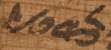   |
| Ḫmnw "Hermopolis [ON]" |  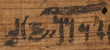 |
| ḫnṱ "stromauf fahren" |   |
| ḫr "[Präfix des Aorists]" |    |
| ḫrw "Stimme" |  |
| ḫt(.w) "Holz, Bäume" |   |
| ẖꜣ(.t) "Gemetzel" |     |
| ẖꜥ.t "Ende" |  |
| ẖn; ẖn⸗ "in [Präp.]" | 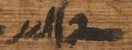       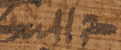 |
| H̱nm "Chnum [GN]" | 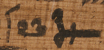  |
| ẖr "Syrer" |   |
| ẖr; ẖr.r.ḥr⸗ "unter, wegen [Präp.]" |   |
| ẖr.t "Speise, Nahrung" |  |
| ẖr-nṯr "Steinmetz" |   |
| ẖrꜣ(.t) "Gewand, Riemen" | 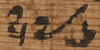 |
| ẖry.w; ẖry "Straße, Weg" |  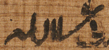 |
| ẖry.t "Witwe" |  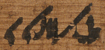 |
| s; st "[enklit. Pron. 3. sg. m.]" |          |
| s.t "Platz, Ort" |  |
| sꜣ "Phyle" |    |
| sỉ-n-ꜥḳ "Bäcker" |   |
| sꜥnḫ "ernähren, leben lassen" |  |
| sw "Monatstag" |            |
| sw-10 "Dekade" |    |
| sbꜣ.w "Tür" |   |
| sbḳ(.w) "klein, gering [Adjektiv]" |  |
| sbt "herrichten, ausrüsten, vorbereiten, versorgen" |  |
| sp "Rest" |    |
| sp "Fall, Angelegenheit, Mal" |  |
| sp-2 "zweimal [Wiederholungszeichen]" |   |
| sf "gestern [Adverb]" |   |
| s[fy] "Messer, Schwert" |  |
| smn "aufsetzen, feststellen, dauern (lassen)" |  |
| smḥ (?) "links" |    |
| smt "Art, Weise, Gestalt" |   |
| sn.w "Bruder" |  |
| ⸢s⸣nty "sich fürchten" |  |
| sḥm.t "Frau" |  |
| sḥn "Krone, Diadem" |   |
| sḥn "Angelegenheit, Amt, Befehl, Auftrag" |  |
| sḥn.ṱ; sḥn "befehlen, beauftragen" |   |
| sḫ(.t) "Feld" |  |
| sẖꜣ "schreiben" |  |
| ssw; ss.w "Termin, Zeit" |           |
| sḳꜣ "zusammenfügen, sammeln" |  |
| sgrꜣ.w "Herde (o.ä.)" |  |
| st "[enklit. Pron. 3. pl. c.]" |  |
| stbḥ(.t) "Gerät, Waffe" |  |
| stbḥ(.t)-n-ḳnḳn "Kampfgerät, Waffen" |  |
| sdb "essen" |  |
| šy(.w) "See" |  |
| šbi̯.t "Veränderung, Tausch, Entgelt" |   |
| ⸢šm⸣; šm "gehen" |         |
| šm.w "Gang, Reise" |  |
| šn "Krankheit" |  |
| šn.w "Inspektion, Untersuchung" |  |
| šni̯ "fragen, suchen, untersuchen" |       |
| šni̯ "krank sein" |  |
| šnt(.t); ⸢šnt(.t)⸣ "Schurz, Tuch" |   |
| šrỉ "Sohn" |        |
| šll "beten, flehen" | 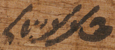 |
| šlly "Wehruf, Wehklage" | 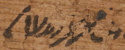 |
| šsp; ⸢šsp⸣ "empfangen" |      |
| ḳb "verdoppeln" |  |
| ḳbꜣ(.t) "Gefäß, Krug" |  |
| ḳn "Stärke, Sieg" |  |
| ḳnḥ.t "Schrein, Naos" | 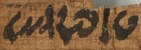 |
| ḳnḳn "schlagen, kämpfen" |   |
| ḳlꜣ.t; ḳlꜣ.w(t) "Riegel, Zapfen" |   |
| ḳdy "umherziehen" |  |
| k.ṱ.t "andere [sg. f.]" |   |
| kꜣm "Garten" | 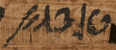 |
| kꜣmy "Gärtner, Winzer" |  |
| kỉỉ.w "anderer [sg. m.]" |  |
| Km "Ägypten" |                |
| gbꜣ.t "Sproß, Blatt, Nachkommenschaft" | 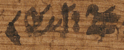 |
| gby.w "Schwacher" |  |
| gmi̯ "finden" |       |
| grp "öffnen, enthüllen, offenbaren" |  |
| gsgs "tanzen" |  |
| gst "Palette" |   |
| gḏwḏꜣ "Mensch aus Gaza, Diener" | 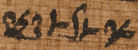 |
| tꜣ "Land, Welt, Erde" |     |
| tꜣ; ⸢tꜣ⸣ "die [def. Artikel sg. f.]" |                                                     |
| Tꜣ-Mḥy "Unterägypten" |  |
| Tꜣ-Šmꜥ "Oberägypten [ON]" |   |
| tꜣỉ "[Kopula sg. f.]" |        |
| tꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| tꜣy⸗f "seine" |     |
| tꜣy⸗s "ihre" |    |
| tꜣy⸗k "deine" |     |
| ta "die von" |  |
| Ta-bꜣ.ỉyi̯ "Tabis(?)" | 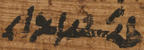 |
| tw⸗ỉ "[proklit. Pron. 1. sg. c.]" |   |
| tw⸗n "[proklit. Pron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸢tw⸣⸗tn "[proklit. Pron. 2. pl. c.]" |  |
| twꜣ "Berg" |  |
| twtw "sammeln, sich versammeln" |  |
| tp.t; tp "erster [Adjektiv]" |   |
| tpy.t "Anfang" | 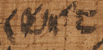 |
| tm "[Negationsverb]" |    |
| tm-hp "Unrecht" |  |
| ṱrry "Ofen" |  |
| tḫ(?)s(.t) "?" |  |
| ṱkn "nahe kommen, eilen" |   |
| ṯꜣi̯ "nehmen, empfangen" |     |
| dp-n-ỉꜣw.w(t) "Vieh" |  |
| Dpꜣy; Dpꜣ; Dpyꜣ "Dep (Stadtteil von Buto) [ON]" |    |
| dmḏ "Summe" |         |
| dnỉ(.t) "Anteil" |  |
| dšry(.t) "Rote Krone" |  |
| ḏꜣḏꜣ "Kopf" |     |
| ḏi̯; ḏi̯.t; ḏi̯⸗ "geben" |                                      |
| ḏm "Geschlecht, Nachkomme, Generation; Jungmannschaft; Kalb" |  |
| ḏmꜥy "trauern, klagen" | 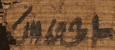 |
| ḏn⸢f⸣; ḏnf "Gewicht, Maß, Gleichgewicht" |   |
| ḏr(.t); ḏr(.t)⸗ "Hand" |    |
| ḏr⸗ "ganz, alle" |   |
| ḏrꜣ; ḏ⸢r⸣ꜣ "stark, siegreich sein [Adjektivverb]" |     |
| ḏlḏ "Pflanzung, Hecke (?)" |   |
| Ḏḥw.tỉ "Thot [GN]" |   |
| Ḏd "Djed-Pfeiler" |   |
| ḏd; ⸢ḏd⸣ "[Konjunktion]" |                                                                                                 |
| ḏd.ṱ; ḏd; (r:)ḏd "sagen, sprechen" |                             |
| Ḏd-ḥr "Tachos, Taos [KN]" | 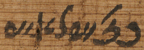 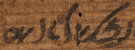 |
| 1; (sw)-1 "Tag 1" |     |
| 10 "10" |  |
| 13 "13" |  |
| 16 "16" |   |
| 18 "18" |   |
| 19 "19" | 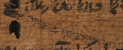 |
| 2 "(Tag) 2" |  |
| 2.nw; {2.nw} "zweiter" |   |
| 3 "(Tag) 3" |  |
| 3; 3.t "3" |      |
| 4 "(Tag) 4" |  |
| 5 "(Tag) 5" |  |
| 5.t "5" |   |
| 6 "(Tag) 6" |  |
| 6 "6" |   |
| 7 "7" |  |
| 7; (sw)-7 "(Tag) 7" |   |
| :**𓅓1𓄿1** | :𓅓𓄿 |  |
| :𓎆 | :𓎆 |    |
| :𓏾 | :𓏾 |  |
| :𓐀 | :𓐀 |  |
| :𓐂 | :𓐂 |  |
| 𓀀3 | 𓀀 |   |
| 𓀀:𓈖 |   | |
| 𓀁 | 𓀁 |                                                                           |
| 𓀁1 | 𓀁 |  |
| 𓀁° | 𓀁 |                          |
| 𓀎 | 𓀎 |  |
| 𓀎𓏰:𓀀𓀁 | 𓀎 |  |
| 𓀐 | 𓀐 |                                                 |
| 𓀐1 | 𓀐 |   |
| 𓀔 | 𓀔 |                      |
| 𓀗 | 𓀗 |     |
| 𓀢2 | 𓀢 |  |
| 𓀨 | 𓀨 |   |
| 𓀹1 | 𓀹 |  |
| 𓀼 | 𓀼 |   |
| 𓁐9 | 𓁐 |  |
| 𓁗1 | 𓁗 |   |
| 𓁗1:° | 𓁗 |  |
| 𓁶𓏤1 | 𓁶𓏤 |      |
| 𓁶𓏤1𓊪1 | 𓁶𓏤𓊪 |  |
| 𓁶𓏤1𓊪1:° | 𓁶𓏤𓊪 |    |
| 𓁷𓏤 | 𓁷𓏤 |                       |
| 𓁷𓏤1𓀀3 | 𓁷𓏤𓀀 |   |
| 𓁹:𓂋*𓏭 |                                                                                  | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑 |                 | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑1 |    | |
| 𓁹:𓏏*𓏤𓁻1 |   | |
| 𓁻2 | 𓁻 |  |
| 𓁻:° | 𓁻 |           |
| 𓂊2:° | 𓂊 |   |
| 𓂋 | 𓂋 |               |
| 𓂋1 | 𓂋 |                                                                            |
| 𓂋1𓂋:𓆑 | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓎡° | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓏥𓏲 | 𓂋 |     |
| 𓂋3𓌥 | 𓂋𓌥 |      |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1'𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲 |   |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲𓏲 |    |
| 𓂋:𓂋 |    | |
| 𓂋:𓂧 |      | |
| 𓂋:𓂧:° |  | |
| 𓂋:𓂧:°𓌗1 |  | |
| 𓂋:𓂧@ |   | |
| 𓂋:𓂧@𓂾𓂾 |   | |
| 𓂋:𓂧𓂾𓂾 |  | |
| 𓂋:𓂧𓌗1 |    | |
| 𓂋:𓂧𓌗2 |  | |
| 𓂋:𓆑 |  | |
| 𓂋:𓊪 |    | |
| 𓂋:𓍿𓀀𓏪 |          | |
| 𓂋:𓎡 |  | |
| 𓂋:𓎡° |  | |
| 𓂋:𓏏*𓏰 |            | |
| 𓂋:𓏥𓏲 |     | |
| 𓂋:𓐍 |   | |
| 𓂓𓏤1 | 𓂓𓏤 |  |
| 𓂓𓏤2 | 𓂓𓏤 |   |
| 𓂚3 | 𓂚 |  |
| 𓂚3𓍘𓇋4 | 𓂚𓍘𓇋 |  |
| 𓂜1 | 𓂜 |  |
| 𓂜1:𓅪 |  | |
| 𓂝 | 𓂝 |          |
| 𓂝:𓂝:° |  | |
| 𓂝:𓂝:°𓏤 |  | |
| 𓂝:𓂝𓏤 |  | |
| 𓂝:𓂻 |         | |
| 𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥 |       | |
| 𓂝:𓈖 |  | |
| 𓂝:𓈖:° |  | |
| 𓂝:𓈖𓏌𓏲1 |  | |
| 𓂝:𓈙𓀞2 |    | |
| 𓂞:𓏏2 |          | |
| 𓂞:𓏏3 |                   | |
| 𓂞:𓏏6 |                 | |
| 𓂞:𓏏6𓏲 |                 | |
| 𓂧 | 𓂧 |   |
| 𓂧':𓏭 |               | |
| 𓂧:𓏏*𓏤 |            | |
| 𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 |   |
| 𓂷:𓂡1 |    | |
| 𓂷:𓂡1:° |  | |
| 𓂸:𓏏 |   | |
| 𓂸:𓏏𓂭𓂭 |   | |
| 𓂺1 | 𓂺 |  |
| 𓂻 | 𓂻 |                 |
| 𓂻1:° | 𓂻 |  |
| 𓂻:° | 𓂻 |                                  |
| 𓂼1 | 𓂼 |  |
| 𓂼2 | 𓂼 |  |
| 𓂼2𓂼1 | 𓂼𓂼 |  |
| 𓂽 | 𓂽 |  |
| 𓂽1 | 𓂽 |    |
| 𓂽:° | 𓂽 |  |
| 𓂾𓂾 | 𓂾𓂾 |    |
| 𓃀 | 𓃀 |   |
| 𓃀3𓏲1 | 𓃀𓏲 |        |
| 𓃀4𓏲4 | 𓃀𓏲 |  |
| 𓃀:𓈖1 |                  | |
| 𓃀:𓈖1:° |         | |
| 𓃀:𓈖1:°𓊪:𓏭2 |  | |
| 𓃀:𓈖1𓊪:𓏭2 |            | |
| 𓃀𓏲1 | 𓃀𓏲 |                |
| **𓃀𓏲1𓅃𓅆'**:𓎡1 |  | |
| 𓃂 | 𓃂 |                |
| 𓃂𓈘:𓈇 | 𓃂 |    |
| 𓃂𓈘:𓈇:° | 𓃂 |             |
| 𓃛 | 𓃛 |     |
| 𓃛𓃛 | 𓃛𓃛 |   |
| 𓃭 | 𓃭 |                                            |
| 𓃭𓏤 | 𓃭𓏤 |                      |
| 𓃹:𓈖 |    | |
| 𓃹:𓈖2 |            | |
| 𓄂:𓏏*𓏤 |          | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1𓄣𓏤 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤 |  | |
| 𓄋:𓊪1 |   | |
| 𓄋:𓊪@ |      | |
| 𓄋:𓊪@𓏲𓏭:𓏛 |     | |
| 𓄑:𓏛1 |                       | |
| 𓄑:𓏛@ |   | |
| 𓄖:𓂻 |      | |
| 𓄛1 | 𓄛 |    |
| 𓄛2 | 𓄛 |  |
| 𓄟1 | 𓄟 |  |
| 𓄡:𓏏*𓏤 |    | |
| 𓄣1𓏤1 | 𓄣𓏤 |  |
| 𓄣𓏤 | 𓄣𓏤 |       |
| 𓄤 | 𓄤 |        |
| 𓄤𓏭:𓏛 | 𓄤 |        |
| 𓄧 | 𓄧 |   |
| 𓄹:𓏭 |                                      | |
| 𓄿 | 𓄿 |      |
| 𓄿1 | 𓄿 |                                                     |
| 𓄿:° | 𓄿 |         |
| 𓄿:°𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓄿𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓅃𓅆 | 𓅃𓅆 |     |
| 𓅆 | 𓅆 |                                                                                       |
| 𓅆@ | 𓅆 |      |
| 𓅆@° | 𓅆 |   |
| 𓅆° | 𓅆 |      |
| 𓅐 | 𓅐 |      |
| 𓅐𓏏:𓆇 | 𓅐 |    |
| 𓅐𓏲2𓏏:𓆇 | 𓅐𓏲 |  |
| 𓅓 | 𓅓 |                                                   |
| 𓅓'𓎔 | 𓅓𓎔 |  |
| 𓅓1 | 𓅓 |                                                                 |
| 𓅓1𓄿1 | 𓅓𓄿 |  |
| 𓅓1𓅐𓏏:𓆇 | 𓅓𓅐 |  |
| 𓅓1𓈖:𓏥 | 𓅓 |  |
| 𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓅓𓐠𓏤 |                     |
| 𓅓:𓏏 |  | |
| 𓅓:𓏏𓀐 |  | |
| 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 | 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 |  |
| 𓅓𓎔 | 𓅓𓎔 |        |
| 𓅓𓏭 | 𓅓𓏭 |    |
| 𓅓𓏭:𓏛 | 𓅓 |    |
| 𓅓𓏭:𓏛@ | 𓅓 |  |
| 𓅝:𓏏*𓏭 |   | |
| 𓅝:𓏏*𓏭𓅆 |   | |
| 𓅠 | 𓅠 |       |
| 𓅠𓏭:𓏛 | 𓅠 |       |
| 𓅡◳𓏤 |                     | |
| 𓅨:𓂋*𓏰 |     | |
| 𓅪 | 𓅪 |       |
| 𓅪:° | 𓅪 |      |
| 𓅯𓄿 | 𓅯𓄿 |                                                                                                                                            |
| 𓅯𓄿3 | 𓅯𓄿 |  |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓅯𓄿𓇋𓇋 |     |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 | 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 |                             |
| 𓅯𓄿𓏭1 | 𓅯𓄿𓏭 |                                        |
| 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 | 𓅯𓄿𓏲 |   |
| 𓅱 | 𓅱 |     |
| 𓅱𓃀4𓏲4 | 𓅱𓃀𓏲 |  |
| 𓆄 | 𓆄 |   |
| 𓆇:𓏤 |    | |
| 𓆈:𓏥 |    | |
| 𓆊 | 𓆊 |        |
| 𓆎 | 𓆎 |  |
| 𓆎@2 | 𓆎 |               |
| 𓆎@2𓅓1 | 𓆎𓅓 |               |
| 𓆎𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆑 | 𓆑 |                                                                                                                         |
| 𓆑1 | 𓆑 |       |
| 𓆑1𓅆 | 𓆑𓅆 |        |
| 𓆑4 | 𓆑 |     |
| 𓆑:𓏭 |   | |
| 𓆓:𓂧 |                                                                                                                                 | |
| 𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3 |   | |
| 𓆙 | 𓆙 |             |
| 𓆛:𓈖 |    | |
| 𓆣:𓂋𓏲 |                                                         | |
| 𓆤1 | 𓆤 |   |
| 𓆤1:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓆮 | 𓆮 |      |
| 𓆰:𓈖𓏪:° |       | |
| 𓆰𓏪 | 𓆰𓏪 |      |
| 𓆱:𓏏*𓏤 |                      | |
| 𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥:° |   | |
| 𓆱:𓏥:° |   | |
| 𓆳 | 𓆳 |           |
| 𓆳𓏤𓏰:𓇳5 | 𓆳𓏤 |           |
| 𓆷 | 𓆷 |  |
| 𓆷1 | 𓆷 |     |
| 𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳1 | 𓆷𓏰𓏰 |     |
| 𓆸 | 𓆸 |      |
| 𓆼 | 𓆼 |               |
| 𓆼1 | 𓆼 |        |
| 𓆼𓄿3 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿3𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿5 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿5𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿𓂝:𓂻1 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓇇 | 𓇇 |  |
| 𓇋1 | 𓇋 |        |
| 𓇋1𓇋𓀀 | 𓇋𓇋𓀀 |  |
| 𓇋1𓏏:𓆑 | 𓇋 |    |
| 𓇋2 | 𓇋 |            |
| 𓇋2𓂋:𓊪 | 𓇋 |  |
| 𓇋2𓆛:𓈖 | 𓇋 |    |
| 𓇋5 | 𓇋 |         |
| 𓇋5:𓎡 |         | |
| 𓇋𓀁 | 𓇋𓀁 |             |
| 𓇋𓀁1 | 𓇋𓀁 |                                     |
| 𓇋𓀁1𓋴𓏏 | 𓇋𓀁𓋴𓏏 |   |
| 𓇋𓀁𓂋:𓎡 | 𓇋𓀁 |  |
| 𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤 | 𓇋𓀁 |            |
| 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛 | 𓇋𓀁𓏤 |       |
| 𓇋𓂋:𓏭 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓂋:𓏭𓀹1 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓇋 | 𓇋𓇋 |           |
| 𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓇋𓇋 |          |
| 𓇋𓇋𓆑 | 𓇋𓇋𓆑 |    |
| 𓇋𓇋𓏲 | 𓇋𓇋𓏲 |                                                                                                                          |
| 𓇋𓈖 | 𓇋𓈖 |       |
| 𓇋𓋴𓏏 | 𓇋𓋴𓏏 |                        |
| 𓇋𓎛𓃒 | 𓇋𓎛𓃒 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖 | 𓇋 |     |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆 | 𓇋 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆° | 𓇋 |  |
| 𓇋𓏲 | 𓇋𓏲 |                                                                                                                           |
| 𓇋𓏲 𓏪3 | 𓇋𓏲 𓏪 |  |
| 𓇋𓏲𓆑 | 𓇋𓏲𓆑 |                       |
| 𓇋𓏲𓏪 | 𓇋𓏲𓏪 |   |
| 𓇍1𓇋1 | 𓇍𓇋 |             |
| 𓇍1𓇋1𓂻 | 𓇍𓇋𓂻 |             |
| 𓇏:° | 𓇏 |  |
| 𓇓1 | 𓇓 |                   |
| 𓇓1𓅆 | 𓇓𓅆 |          |
| 𓇘 | 𓇘 |   |
| 𓇘:𓏏*𓏰𓅓 |   | |
| 𓇛1 | 𓇛 |   |
| 𓇣𓂧:𓏏*𓏰𓌽:𓏥1 | 𓇣 |   |
| 𓇥:𓂋1 |       | |
| 𓇥:𓂋1𓏭:𓏛 |   | |
| 𓇥:𓂋1𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2 |  | |
| 𓇥:𓂋2𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇯 | 𓇯 |                                             |
| 𓇳 | 𓇳 |                            |
| 𓇳𓅆 | 𓇳𓅆 |      |
| 𓇳𓍼:𓏤 | 𓇳 |     |
| 𓇳𓍼:𓏤° | 𓇳 |  |
| 𓇳𓏤 | 𓇳𓏤 |   |
| 𓇹 | 𓇹 |   |
| 𓇹:𓇼 |   | |
| 𓇹:𓇼:𓇳 |   | |
| 𓇺:𓏺 |  | |
| 𓇺:𓏺1 |  | |
| 𓇺:𓏻1 |     | |
| 𓇺:𓏼@ |        | |
| 𓇺:𓏽@ |   | |
| 𓇾:𓏤@ |   | |
| 𓇾:𓏤𓈇@ |   | |
| 𓈉2 | 𓈉 |        |
| 𓈉2:𓏏*𓏤 |        | |
| 𓈌 | 𓈌 |   |
| 𓈌:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓈍:𓂝*𓏛 |      | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆 |    | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆° |  | |
| 𓈎 | 𓈎 |               |
| 𓈎:° | 𓈎 |  |
| 𓈎:𓈖 |     | |
| 𓈎:𓈖@ |  | |
| 𓈎:𓈖𓏌𓏲1 |   | |
| 𓈐':𓏏*𓏤 |  | |
| 𓈐:𓂻 |     | |
| 𓈐:𓂻@ |  | |
| 𓈒 | 𓈒 |  |
| 𓈒:𓏥 |  | |
| 𓈒:𓏥1 |   | |
| 𓈔 | 𓈔 |   |
| 𓈖 | 𓈖 |                                                               |
| 𓈖1 | 𓈖 |                   |
| 𓈖1:**𓄿1'𓇋𓇋𓏲** |   | |
| 𓈖1:**𓇛1𓅓1** |   | |
| 𓈖2 | 𓈖 |                                  |
| 𓈖2:𓌳° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖 |           | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁 |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁 |          | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁° |  | |
| 𓈖:𓄿 |                                                                                            | |
| 𓈖:𓄿° |                 | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |  | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑 |  | |
| 𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4 |       | |
| 𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥 |   | |
| 𓈖:𓈖9 |   | |
| 𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 |       | |
| 𓈖:𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖:**𓋴𓆰:𓈖𓏪:°** |       | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲 |       | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1 |     | |
| 𓈖:𓎡2 |  | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 |    | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 |    | |
| 𓈖:𓏌*𓏲 |             | |
| 𓈖:𓏏 |  | |
| 𓈖:𓏏*𓏭1 |                                                                                | |
| 𓈖:𓏥 |      | |
| 𓈖:𓏲*𓏥 |     | |
| 𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 | 𓈖𓇋𓅓 |                       |
| 𓈗 | 𓈗 |         |
| 𓈗𓈘:𓈇 | 𓈗 |         |
| 𓈘:𓈇 |             | |
| 𓈘:𓈇:° |             | |
| 𓈙 | 𓈙 |                 |
| 𓈝 | 𓈝 |                |
| 𓈝𓂻:° | 𓈝𓂻 |                |
| 𓉐:𓉻 |                  | |
| 𓉐:𓉻𓅆 |                  | |
| 𓉐𓏤 | 𓉐𓏤 |                               |
| 𓉐𓏤1 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@1 | 𓉐𓏤 |                               |
| 𓉐𓏤@2 | 𓉐𓏤 |    |
| 𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |            |
| 𓉔 | 𓉔 |                           |
| 𓉔1 | 𓉔 |    |
| 𓉗1 | 𓉗 |                       |
| 𓉗1𓉐𓏤@1 | 𓉗𓉐𓏤 |                 |
| 𓉞 | 𓉞 |   |
| 𓉺1 | 𓉺 |  |
| 𓉺1:𓏏*𓏰𓏌 |  | |
| 𓉻 | 𓉻 |    |
| 𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 |    | |
| 𓉻:𓂝*𓏛 |                                                | |
| 𓉿:𓂡1 |            | |
| 𓊃 | 𓊃 |      |
| 𓊃:𓀀:𓈖 |   | |
| 𓊃:𓈞𓁐2 |  | |
| 𓊌1 | 𓊌 |         |
| 𓊏 | 𓊏 |      |
| 𓊏𓏭:𓏛 | 𓊏 |      |
| 𓊑1 | 𓊑 |     |
| 𓊖 | 𓊖 |  |
| 𓊗:𓏻1 |   | |
| 𓊡 | 𓊡 |    |
| 𓊡𓏭:𓏛 | 𓊡 |  |
| 𓊡𓏲𓏭:𓏛 | 𓊡𓏲 |   |
| 𓊢𓂝:𓂻 | 𓊢 |     |
| 𓊤 | 𓊤 |  |
| 𓊤𓏲 | 𓊤𓏲 |  |
| 𓊨 | 𓊨 |    |
| 𓊨:° | 𓊨 |   |
| 𓊨:°𓏤𓉐𓏤 | 𓊨𓏤𓉐𓏤 |  |
| 𓊨𓏏:𓆇1 | 𓊨 |    |
| 𓊪 | 𓊪 |         |
| 𓊪1 | 𓊪 |               |
| 𓊪1:° | 𓊪 |     |
| 𓊪1:𓉐𓏤1 |   | |
| 𓊪:° | 𓊪 |    |
| 𓊪:𓏏𓎛 |    | |
| 𓊪:𓏏𓎛𓅆 |    | |
| 𓊪:𓏭 |       | |
| 𓊪:𓏭2 |             | |
| 𓊮 | 𓊮 |  |
| 𓊵:𓏏@1 |  | |
| 𓊹 | 𓊹 |         |
| 𓊹𓅆 | 𓊹𓅆 |    |
| 𓊹𓅆° | 𓊹𓅆 |   |
| 𓊹𓊹𓊹1 | 𓊹𓊹𓊹 |      |
| 𓊹𓍛𓏤:𓀀 | 𓊹𓍛 |     |
| 𓊽 | 𓊽 |   |
| 𓊽1 | 𓊽 |   |
| 𓊽1𓊽1 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓊽𓊽 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓋀 | 𓋀 |     |
| 𓋀𓏤 | 𓋀𓏤 |    |
| 𓋀𓏤𓏰:𓊖3 | 𓋀𓏤 |  |
| 𓋁𓃀1 | 𓋁𓃀 |  |
| 𓋁𓃀1𓏤𓊖 | 𓋁𓃀𓏤𓊖 |  |
| 𓋞:𓈒*𓏥1 |   | |
| 𓋩1 | 𓋩 |   |
| 𓋩2 | 𓋩 |  |
| 𓋴 | 𓋴 |                                                  |
| 𓋴@𓏤 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴@𓏤𓄹:𓏭 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴𓇋1𓅨:𓂋*𓏰 | 𓋴𓇋 |  |
| 𓋴𓏏 | 𓋴𓏏 |                                               |
| 𓋴𓏏1𓏏 | 𓋴𓏏𓏏 |   |
| 𓋹𓈖:𓐍 | 𓋹 |         |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |          |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏2 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |                       |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏4 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |      |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰 | 𓌃 |       |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁 | 𓌃 |     |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁° | 𓌃 |   |
| 𓌉 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥1 | 𓌉 |  |
| 𓌗1 | 𓌗 |     |
| 𓌗2 | 𓌗 |  |
| 𓌙:𓈉 |                   | |
| 𓌙:𓈉1 |    | |
| 𓌞:𓊃 |   | |
| 𓌞:𓊃1 |   | |
| 𓌞:𓊃1𓂻:° |   | |
| 𓌞:𓊃𓇋𓏲𓂻 |   | |
| 𓌢° | 𓌢 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌨:𓂋𓏭:𓏛 |     | |
| 𓌪:𓂡 |      | |
| 𓌳° | 𓌳 |  |
| 𓌶:𓂝2 |   | |
| 𓌶:𓂝2𓆄 |   | |
| 𓌻 | 𓌻 |     |
| 𓌻𓀁 | 𓌻𓀁 |  |
| 𓌻𓏭:𓏛1𓀁 | 𓌻 |    |
| 𓍃 | 𓍃 |    |
| 𓍃𓅓𓏭:𓏛 | 𓍃𓅓 |    |
| 𓍊𓏤 | 𓍊𓏤 |    |
| 𓍑 | 𓍑 |                 |
| 𓍑𓄿3 | 𓍑𓄿 |     |
| 𓍑𓍑 | 𓍑𓍑 |     |
| 𓍘 | 𓍘 |  |
| 𓍘1 | 𓍘 |              |
| 𓍘1𓎟:𓏏1 | 𓍘 |        |
| 𓍘𓇋2 | 𓍘𓇋 |    |
| 𓍘𓇋4 | 𓍘𓇋 |    |
| 𓍘𓈖:𓏏 | 𓍘 |  |
| 𓍘𓈖:𓏏1 | 𓍘 |  |
| 𓍬:𓂻':° |  | |
| 𓍯 | 𓍯 |                              |
| 𓍱 | 𓍱 |    |
| 𓍱1 | 𓍱 |  |
| 𓍱:𓂡1 |  | |
| 𓍱:𓂡1𓏏 |  | |
| 𓍴 | 𓍴 |       |
| 𓍴1 | 𓍴 |  |
| 𓍴1𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖9 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |       |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2 | 𓍴 |    |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓋩2 | 𓍴 |  |
| 𓍸𓏛1 | 𓍸𓏛 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |                                |
| 𓍺 | 𓍺 |                            |
| 𓍼:𓏤1 |   | |
| 𓍼:𓏥 |  | |
| 𓎃° | 𓎃 |    |
| 𓎆 | 𓎆 |            |
| 𓎔 | 𓎔 |  |
| 𓎔2 | 𓎔 |                |
| 𓎔2: | 𓎔: |          |
| 𓎔:𓏺 |   | |
| 𓎔:𓏻 |      | |
| 𓎔:𓏼 |      | |
| 𓎔:𓏽 |    | |
| 𓎛 | 𓎛 |     |
| 𓎛1 | 𓎛 |  |
| 𓎛2 | 𓎛 |        |
| 𓎛2𓐑:𓊪𓏲1 | 𓎛 |        |
| 𓎛𓂝:𓏏𓄹 | 𓎛 |   |
| 𓎝𓎛 | 𓎝𓎛 |  |
| 𓎟:𓏏 |        | |
| 𓎟:𓏏1 |   | |
| 𓎡 | 𓎡 |                  |
| 𓎡1 | 𓎡 |          |
| 𓎡1:𓇋1𓇋𓀀 |  | |
| 𓎡:𓍘𓇋 |   | |
| 𓎨 | 𓎨 |   |
| 𓎭 | 𓎭 |    |
| 𓎱1 | 𓎱 |    |
| 𓎱1:𓇳 |    | |
| 𓎸 | 𓎸 |   |
| 𓎸1 | 𓎸 |  |
| 𓎸𓅓𓏰:𓇳1 | 𓎸𓅓 |   |
| 𓎼 | 𓎼 |             |
| 𓏇1 | 𓏇 |   |
| 𓏇1𓇋1 | 𓏇𓇋 |   |
| 𓏌 | 𓏌 |       |
| 𓏌:𓈖 |     | |
| 𓏌:𓈖:° |     | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤 |    | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤@1 |  | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤 |   | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤@1 |   | |
| 𓏌𓏲1 | 𓏌𓏲 |          |
| 𓏌𓏲2 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏌𓏲𓍖:𓏛 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏎:𓈖 |   | |
| 𓏏 | 𓏏 |                                                                         |
| 𓏏*𓏤 | 𓏏𓏤 |        |
| 𓏏*𓏰 | 𓏏𓏰 |        |
| 𓏏1 | 𓏏 |              |
| 𓏏1:° | 𓏏 |  |
| 𓏏:° | 𓏏 |   |
| 𓏏:𓄿 |                                                                | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |     | |
| 𓏏:𓄿𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑 |    | |
| 𓏏:𓄿𓏭 |        | |
| 𓏏:𓆇 |         | |
| 𓏏:𓆇1 |   | |
| 𓏏:𓆑 |    | |
| 𓏏:𓈇𓏤@1 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥:° |    | |
| 𓏛 | 𓏛 |    |
| 𓏛𓏏 | 𓏛𓏏 |  |
| 𓏞𓍼:𓏤 | 𓏞 |  |
| 𓏞𓍼:𓏤@ | 𓏞 |  |
| 𓏠:𓈖 |        | |
| 𓏠:𓈖1 |   | |
| 𓏠:𓈖1:° |   | |
| 𓏠:𓈖1:°𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |   | |
| 𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛 |  | |
| 𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |  | |
| 𓏤 | 𓏤 |                                  |
| 𓏤1𓈘:𓈇 | 𓏤 |  |
| 𓏤𓊖 | 𓏤𓊖 |   |
| 𓏤𓏰:𓇳5 | 𓏤 |           |
| 𓏤𓏰:𓊖1 | 𓏤 |  |
| 𓏤𓏰:𓊖3 | 𓏤 |                      |
| 𓏥 | 𓏥 |    |
| 𓏪 | 𓏪 |                                                                                                                       |
| 𓏪1 | 𓏪 |                               |
| 𓏪1° | 𓏪 |   |
| 𓏪3 | 𓏪 |                                     |
| 𓏫 | 𓏫 |   |
| 𓏫1:° | 𓏫 |   |
| 𓏫:° | 𓏫 |   |
| 𓏭:𓂢 |    | |
| 𓏭:𓏛 |                                               | |
| 𓏭:𓏛1 |                  | |
| 𓏰:𓀀 |  | |
| 𓏰:𓇳1 |                | |
| 𓏰:𓇳1@ |           | |
| 𓏰:𓇳2𓏤2 |      | |
| 𓏰:𓊖2° |    | |
| 𓏲 | 𓏲 |                  |
| 𓏲1 | 𓏲 |       |
| 𓏲2 | 𓏲 |   |
| 𓏲:𓏏 |                 | |
| 𓏲:𓏏𓏤 |     | |
| 𓏲𓏭:𓏛 | 𓏲 |                                     |
| 𓏴:𓂡 |            | |
| 𓏴:𓂡𓍘1 |         | |
| 𓏴:𓏛4 |   | |
| 𓏴:𓏛4𓀁 |   | |
| 𓏶 | 𓏶 |      |
| 𓏶𓅓 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓1 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓𓏭 | 𓏶𓅓𓏭 |    |
| 𓏺 | 𓏺 |      |
| 𓏺:𓏏 |    | |
| 𓏻4 | 𓏻 |  |
| 𓏻:𓏌 |   | |
| 𓏼1 | 𓏼 |         |
| 𓏾 | 𓏾 |      |
| 𓏿 | 𓏿 |        |
| 𓐀 | 𓐀 |    |
| 𓐀1 | 𓐀 |  |
| 𓐁 | 𓐁 |    |
| 𓐁1 | 𓐁 |   |
| 𓐁1:𓐋2𓏌𓏲1𓀼 |   | |
| 𓐂 | 𓐂 |   |
| 𓐅 | 𓐅 |  |
| 𓐆 | 𓐆 |  |
| 𓐇 | 𓐇 |  |
| 𓐈1 | 𓐈 |  |
| 𓐉 | 𓐉 |  |
| 𓐊 | 𓐊 |   |
| 𓐋2 | 𓐋 |   |
| 𓐍 | 𓐍 |         |
| 𓐍:𓂋 |     | |
| 𓐍:𓂋𓀁 |     | |
| 𓐍:𓅓 |     | |
| 𓐍:𓅓𓅪 |  | |
| 𓐍:𓅓𓅪:° |    | |
| 𓐍:𓊪2 |   | |
| 𓐍:𓏏*𓏰 |    | |
| 𓐍:𓏭 |        | |
| 𓐑:𓊪 |       | |
| 𓐑:𓊪𓏲1 |  | |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛 | 𓐠𓏤 |       |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓐠𓏤 |                    |
| 𓐪 | 𓐪 |    |
| 𓐪𓂧:𓏏*𓏰 | 𓐪 |  |
| | |  |
| ⸗y "[Suffixpron. 1. sg. c.]" |             |
| ⸗w; [⸗w]; ⸢⸗w⸣ "[Suffixpron. 3. pl. c.]" |                                                                                                       |
| ⸗f; [⸗f]; ⸢⸗f⸣ "[Suffixpron. 3. sg. m.]" |                                                                                                                   |
| ⸗n "[Suffixpron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸗s; ⸢⸗s⸣ "[Suffixpron. 3. sg. f.]" |                                 |
| ⸗k "[Suffixpron. 2. sg. m.]" | 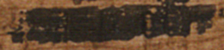       |
| ⸗tn "[Suffixpron. 2. pl. c.]" |    |
| ꜣwy "Lobpreis" |  |
| ꜣbḫ "vergessen" |  |
| ꜣbd "Monat" |   |
| ꜣbd-1 "Monat 1" |   |
| ꜣbd-2 "Monat 2" |     |
| ꜣbd-3; ⸢ꜣbd-3⸣ "Monat 3" |        |
| ꜣbd-4 "Monat 4" |   |
| ꜣbdy "Neulicht, zweiter Tag des Mondmonats" |   |
| ꜣfꜥ(.t); ꜣfꜥ(.w) "gierig [Adjektiv]" |   |
| ꜣrwy "Stengel, Stoppel, Spreu" |   |
| ꜣḥ.w "Acker" |  |
| ꜣḫ(.t) "Überschwemmungsjahreszeit, Achet" |     |
| ꜣs(.t) "Isis [GN]" |   |
| ꜣsḳ "zögern" | 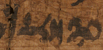 |
| ꜣgy "tüchtig, vorzüglich, vortrefflich" | 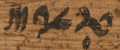 |
| ꜣḏꜣ(.t) "Hacke" | 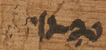 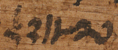 |
| ỉ.ỉr-ḥr; ỉ:ỉr-ḥr "vor, bei, zur Zeit von [Präp.]" |    |
| ỉ.ḳd "Baumeister" |  |
| ỉꜣw.t "Amt, Würde" |    |
| ỉꜣw.t-(n)-ḥrỉ "Herrscheramt" |    |
| ỉꜣb.tỉ "Osten" |  |
| ỉ:ỉri̯ "[Konverter 2. Tempus]" |      |
| ỉ:ỉri̯; (ỉ:)ỉri̯ "[Bildungselement des Partizips]" |                |
| ỉ:ỉri̯⸗f "[Konverter 2. Tempus + Suffixpron. 3. sg. m.]" | 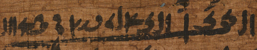   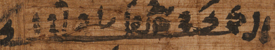      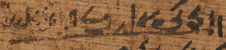 |
| ỉyi̯ "kommen" |            |
| ỉꜥḥ "Mond" |  |
| ỉw; [ỉw] "[Bildungselement des Futur III]" |                                                     |
| ⸢ỉw⸗w⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. pl. c.]" |   |
| ỉw⸗f "er [proklit. Pron. 3. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗f "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗f "wenn er [Konditionalis + Suffixpron. 3. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗f; ỉw⸗f(?) "indem er [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗s "sie [proklit. Pron. 3. sg. f.]" |      |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. f.]" |       |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣; ⸢ỉw⸣⸗s "indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. f.]" |           |
| ỉw⸗k "du [proklit. Pron. 2. sg. m.]" |   |
| ỉw⸗k "indem du [Umstandskonverter + Suffixpron. 2. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗k "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉw⸗k "[Konditionalis + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉwi̯ "kommen" |  |
| ỉwỉw.w; ỉwỉw "Hund" |   |
| Ỉwnw "Heliopolis [ON])" | 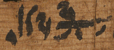 |
| ỉwr "schwanger werden" |  |
| ỉb "Herz" |  |
| ỉbỉ "Honig" |   |
| ỉp "zählen" |   |
| ỉpe.t; ỉpe(.t); ỉp(.t) "Arbeit" |        |
| ỉpre "Sproß, Samen, Korn" |  |
| ỉmn "Amun [GN]" |   |
| ỉmn.tỉ "Westen" |  |
| Ỉmn-ỉ:ỉri̯-ḏi̯.t-s "Amyrtaios [KN]" | 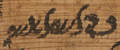  |
| ỉn "[Fragepartikel]" |  |
| ỉn; ⸢ỉn⸣ "[Postnegation]" |     |
| ỉn-nꜣ.w "wenn [Bildungselement Konditionalis]" |  |
| ỉni̯ "holen, bringen" |   |
| ỉne "Stein" |    |
| ỉr.t "Auge" |   |
| ỉrỉ "Gefährte" |  |
| ỉri̯; {ỉri̯}; ỉri̯ (?); ỉ:ỉri̯ "tun, machen" |                                              |
| ỉri̯⸗f "[Verb + Suffixpron. 3. sg. masc.]" |      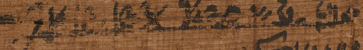   |
| ỉri̯-ḥrỉ "Herrschaft, Regierung" |        |
| ỉri̯-sh̭y "Macht haben über, verfügen über" |  |
| ỉrpy; ỉrp⸢y⸣.w; ỉrpy.w; ỉrpꜣ "Tempel" |     |
| ỉrm "mit, und [Präp.]" |       |
| ỉrm pꜣ ḫpr ꜥn "und ferner" | 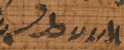 |
| ỉḥ.t "Kuh" |  |
| ỉṱ "Vater" |    |
| yꜥr "Fluß, Kanal" | 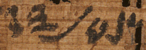 |
| yꜥr-ꜥꜣ "'großer Fluß', Nil" | 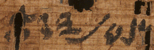 |
| Ybyꜣ "Elephantine [ON]" | 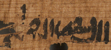 |
| [ꜥ].wỉ; ꜥwỉ.w "Haus, Platz" |   |
| ꜥꜣ "Art, Zustand" |  |
| ꜥꜣ; ꜥy.w "groß [Adjektiv]" |     |
| ꜥw; ꜥꜣ; ꜥy "groß sein [Adjektivverb]" |     |
| ꜥw-n-ỉr.t "Glück" |  |
| ꜥby.t "Spende, Opfer" | 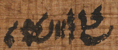 |
| ꜥn "erneut, wieder [Adverb]" |      |
| ꜥnḫ "leben" |     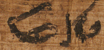  |
| ꜥnḫ "Leben" |  |
| ꜥrꜥy(.t); ꜥry(.t) "Uräusschlange" |        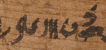 |
| ꜥrwy "vielleicht [Adv.]" | 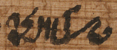 |
| ꜥrḳy "letzter Monatstag" |      |
| ꜥrḏ "Sicherheit, Festigkeit" |  |
| ꜥḥꜥ "stehen" |     |
| ꜥš "rufen" |    |
| ꜥš-šlly "flehen" |  |
| ꜥšꜣ "zahlreich sein [Adjektivverb]" |   |
| ꜥšꜣ "zahlreich [Adjektiv]" |  |
| ꜥḳ "Brot, Ration" |     |
| wꜣḥ-sḥn "befehlen" |  |
| wyꜥ "Bauer" | 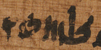 |
| Wynn.w; Wynn(.w) "Grieche" |   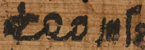 |
| wꜥ.t "eine" |    |
| wꜥb "Priester" |       |
| wꜥb "Reinheit; Reinigung" |  |
| wꜥb.w; wꜥb "rein sein, unbelastet sein" |        |
| wꜥb.t "Balsamierung, Tod" |  |
| wn "öffnen" |            |
| wn "sein, existieren" |    |
| wnm "rechts, rechte Seite" |    |
| wnm "essen" |      |
| wnty.w "Kurzhornrind, Opfertier " |  |
| wr<š>e "Altlicht; Mondmonat" |   |
| whꜥ "böse Tat, Sünde, Verfehlung" |  |
| bỉk.w "Falke" |  |
| bw-ỉri̯; ⸢bw⸣-ỉri̯ "[Negation des Aorists]" |         |
| bn "[Negation]" |  |
| bn.ỉw "[Negation Futur III]" |     |
| bn.ỉw "[Negation Präsens I]" |    |
| bn-p "[Negation Vergangenheit]" |             |
| blꜣ "lösen" |  |
| bš "entblößen, verlassen, reduzieren" |  |
| bgs "sich empören, rebellieren" |  |
| btw "Strafe" | 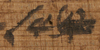    |
| bd(.t) "Emmer" |   |
| p.t; p(.t) "Himmel" |   |
| pꜣ "der [def. Art. sg. m.]" |                                                                                                                               |
| pꜣ tꜣ (n) ẖr "Syrerland, Syrien [ON]" |   |
| pꜣ-bnr-n; pꜣ-bnr-(n) "außer, außerhalb [Präp.]" |   |
| pꜣ-hrw "heute, jetzt [Adverb]" |     |
| Pꜣ-šrỉ-Mw.t "Psammuthis [KN]" |  |
| pꜣỉ "[def. Art. sg. m. + Präfix der Relativform]" |   |
| pꜣỉ "dieser [Demonstrat. sg. m.]" |  |
| pꜣỉ; ⸢pꜣỉ⸣ "[Kopula sg. m.]" |                                     |
| pꜣy⸗w "ihr" |   |
| pꜣy⸗f "sein" |                           |
| pꜣy⸗k "dein" |  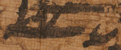   |
| ⸢pa⸣; pa "der von" |       |
| Py "Pe, Buto [ON]" | 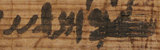  |
| py "Thron" |  |
| pr.w "Haus" |  |
| pr(.t) "Aussaat-Zeit, Peret, Winter" |       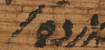     |
| pr-ꜥꜣ "König" |             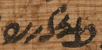    |
| pr-pr-ꜥꜣ "Königspalast" |  |
| Pr-nb(.t)-ṱp-ỉḥ "Aphroditopolis, Atfih [ON]" | 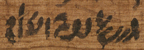 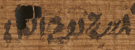 |
| pri̯ "herauskommen" |  |
| prḏꜣ "Kinn(?)" | 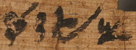 |
| pḥ "erreichen, ankommen" |      |
| pẖrꜣ "herumgehen, durchziehen" | 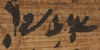 |
| pẖry.w(t); pẖry(.t) "Medikament, Zaubermittel" |    |
| Ptḥ "Ptah [GN]" |    |
| m-sꜣ; m-sꜣ⸗ "hinter [Präp.]" |                     |
| m-ḳdy; ⸢m⸣-ḳdy; m-ḳde "in der Art von [Präp.]" |    |
| m-tw⸗ "bei, jemanden gehören [Präp.]" |      |
| m-tw⸗ "durch [Präp.]" |  |
| m-ḏr; (n)-ḏr.ṱ⸗ "bei, durch [Präp.]" |   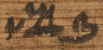    |
| mꜣỉ.w(t) "Insel" |  |
| mꜣꜥ.w; mꜣꜥ "Ort, Platz" |   |
| mꜣḫe.t; mꜣḫe(.t) "Waage" |   |
| mỉ(.t); mỉ.t "Straße" |  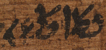 |
| my "[enklitische Partikel nach dem Imperativ]" |  |
| my "[Imperativ von ḏi̯.t]" |    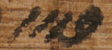 |
| myt "Weg, Rechtsanspruch" |  |
| mꜥḏy "Profit" | 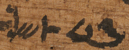  |
| mw "Wasser" |    |
| Mw(.t) "Mut [GN]" |     |
| ⸢mwt⸣ "sterben" |  |
| mn; bn.ỉw "es gibt nicht [Negation der Existenz]" |      |
| [Mn]-nfr; Mn-nfr "Memphis [ON]" |    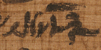 |
| mnḫ "tugendhaft, wohltätig sein [Adjektivverb]" | 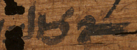   |
| mnḳ "Vollendung" |    |
| mnḳ "vollenden" |  |
| mr.t "Liebe, Beliebtheit, Wunsch, Wille" |  |
| mri̯; mri̯.ṱ⸗ "lieben, wünschen" |    |
| mlẖ "Streit" |  |
| mḥ "füllen" |         |
| mḥ-10.t "zehntes" |  |
| mḥ-11 "elftes" |  |
| mḥ-12 "zwölftes" |  |
| mḥ-13 "dreizehntes" |  |
| [mḥ-14] "vierzehntes" | |
| mḥ-2 "zweiter" |      |
| mḥ-3 "dritter" |      |
| mḥ-4 "vierter" |    |
| mḥ-5 "fünfter" |    |
| mḥ-6 "sechster" |    |
| mḥ-7.t; mḥ-7 "siebtes" |    |
| mḥ-8.t "achtes" |  |
| mḥ-9.t "neuntes" | 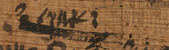 |
| mh̭y "gleichen, vergleichen" |  |
| mh̭y; [m]h̭y; mh̭⸢y⸣ "schlagen" |    |
| ms.t "Geburt" | 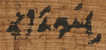 |
| msḥ.w "Krokodil" | 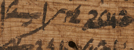 |
| mšꜥ "Armee, Volksgruppe, Menge" |  |
| mšꜥ "gehen, marschieren" |   |
| mtỉ "Flut, Wasser" | 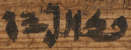 |
| mtw "[Bildungselement des Konjunktivs]" |    |
| mtw⸗s "[selbst. Pron. 3. Sg. f.]" |  |
| mtr "Zeuge sein, zugegen sein" |  |
| md.w(t); md(.t); ⸢md(.t)⸣ "Rede, Wort, Sache, Angelegenheit" |       |
| Mdy.w; Mdy⸢.w⸣; Mdy(.w) "Meder, Perser" | 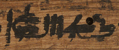 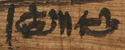          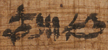 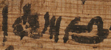  |
| n; ⸢n⸣ "des [Genitiv]" |                |
| n; n.ỉm⸗; ⸢n.ỉm⸗⸣ "in (< m) [Präp.]" |                                                          |
| n; n⸗ "zu, für (< n; Dativ)" |                         |
| n.ỉm "dort [Adverb]" |   |
| n.n⸗w "für sie" |      |
| n⸗k "für dich" |  |
| (n)-bnr "außen, draußen [Adverb]" |  |
| (n)-rn; (n)-rn⸗; ⸢(n)-rn⸣; (n-)rn "besagter, betreffender" |         |
| n-ḏr(.t) "als, nachdem [Temporalis]" |        |
| nꜣ; ⸢nꜣ⸣ "die [def. Art. pl. c.]" |                                                                                  |
| nꜣ.w "[def. Art. pl. c. + Präfix der Relativform]" |      |
| nꜣ.w "für mich" |  |
| nꜣ.w "[Kopula Plural]" |       |
| nꜣ-ꜥn; ꜥn "schön sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣ-nḏm; nḏm "angenehm sein, froh sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣy "diese [Demonstrat. pl. c.]" |   |
| nꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| nꜣy⸗w "ihre" |   |
| nꜣy⸗f "seine" |     |
| Nꜣy⸗f-ꜥw-rd.wỉ "Nepherites [KN]" |  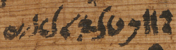 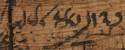 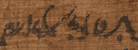  |
| nꜣy⸗n "unsere" |   |
| nꜣy⸗s "ihre" |  |
| nꜣy⸗k "deine" |  |
| nw "sehen" |     |
| nwḥ "Strick" |   |
| nb "Gold" |   |
| ⸢nb⸣ "jeder; irgendein" |  |
| nb; nb.w "Herr" |    |
| nb.t "Frevel, Sünde" |  |
| nb(.t); nb.t "Herrin" |   |
| nb-n-ḫꜥi̯ "Herr der Erscheinungen" |  |
| nfr "gut sein [Adjektivverb]" |   |
| nfr "gut [Adjektiv]" |  |
| nmꜣy(.t)(?) "'Wanderin' (?)" |   |
| nhe(.t) "Sykomore" |  |
| nḫ(?)(.t) "Klage, Totenklage" | 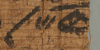 |
| nḫby(.t) "Königstitulatur" | 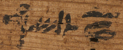 |
| Nḫṱ-nb⸗f "Nektanebos I. [KN]" |  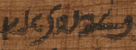 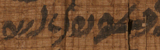 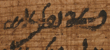     |
| nsw "König" |  |
| nkt "Sache" |    |
| nkt-ḥwrꜥ "Raubgut" |  |
| ntỉ "[Relativkonverter]" |                                                             |
| ntỉ.ỉw "[Relativkonverter]" |                 |
| ntỉ.ỉw⸗f "[Relativkonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |  |
| ntỉ.ỉw⸗k "[Relativkonverter + Suffixpron. 2 sg. m.]" |  |
| ntỉ-ỉri̯ "[Relativkonverter + r im Futur III vor nominalem Subjekt]" |  |
| ntỉ-wꜥb "Sanktuar" |     |
| nṯr "Gott" |      |
| nṯr.w "Götter" |      |
| r "[im Futur III vor nominalem Subjekt]" |       |
| r "[im Futur III vor Infinitiv]" |            |
| r "macht (bei Beträgen u.ä.)" |    |
| r; ỉw; ⸢ỉw⸣ "indem, wobei [Umstandskonverter]" |                |
| r; [r]; r.ḥr⸗ "zu, hin [Präp.]" |                                    |
| r.r⸗w "zu ihnen" |     |
| ⸢r⸣.r⸗f "zu ihm" |  |
| r.r⸗k "zu dir" |   |
| r-wbꜣ "gegen, gegenüber, vor [Präp.]" |  |
| r-bnr "heraus [Adverb]" |  |
| r-ḥr "auf, vor [Präp.]" |  |
| r-ẖ(.t) "in der Art von, entsprechend [Präp.]" |    |
| (r)-ḏbꜣ; (r)-ḏbꜣ⸗; ⸢(r)-ḏbꜣ⸣ "wegen [Präp.]" | 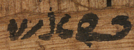    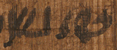 |
| Rꜥ "Re [GN]" |      |
| rmy "weinen, beweinen" | 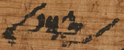  |
| rmy(.t) "Träne" |  |
| rmṯ; rmṯ.w "Mensch, Mann" |          |
| rmṯ-(n)-ḳnḳn "Krieger" |  |
| rn "Name" |    |
| rnp(.t); rnp.w(t) "Jahr" |           |
| rḫ; ỉr.rḫ "wissen, können" |   |
| rše; ršy "sich freuen" | 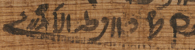  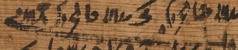  |
| ršy "Freude" |  |
| (r:)ḳd "bauen" |  |
| rd.wỉ "Fuß" |  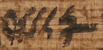  |
| lk "aufhören, beseitigen" |        |
| <mḥ-1>; mḥ-1 "erster" |   |
| <3.nw> "dritter" | |
| hꜣ; ⸢h⸣[ꜣ] "Zeit" |           |
| ⸢hp⸣; hp "Recht, Gesetz, Gesetzanspruch" |         |
| hri̯.w "zufrieden sein, besänftigt sein" |  |
| Hgr; Hḳr "Hakoris [KN]" |  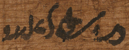 |
| htmꜣ "Thron" |  |
| ḥꜣ(.t) "vor [Präp.]" |   |
| ḥꜣ.t; ḥꜣ(.t) "Vorderteil, Anfang, Spitze" |     |
| ḥꜣ.tỉ; ḥꜣ.tỉ⸗ "Herz" |      |
| ḥꜣṱ; ḥꜣṱ.t "erster, früherer [Adjektiv]" |   |
| ḥꜥ⸗ "selbst" |   |
| ḥw.ṱ "Ackerbauer" |  |
| Ḥw.t-nn-nsw; Ḥw.t-(nn)-nsw "Herakleopolis [ON]" |    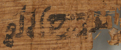   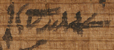   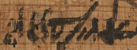 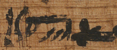 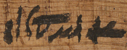 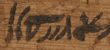  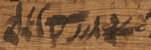  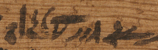 |
| ḥwe(.t); ḥwe.t; ⸢ḥwe⸣[.t] "Kapitel, Strophe" |         |
| ḥwy "Regen" |   |
| ḥwy "schlagen, werfen" |  |
| ḥwrꜥ "rauben, berauben" |   |
| ḥwrꜥ; ḥwrꜥ(.w) "Raub, Räuberei" |    |
| ḥwṱ "Mann, männlich" |  |
| ḥbs "bekleiden, bedecken" | 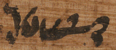 |
| ḥbs.w "Kleidung" |  |
| Ḥp "Apisstier [GN]" |        |
| ḥm.t "Frau, Ehefrau" |  |
| ḥm-nṯr; ⸢ḥm-nṯr(?)⸣ "Gottesdiener, Prophet" |     |
| ḥmꜣ.t "Gebärmutter" |   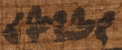 |
| ḥn "befehlen" |   |
| ḥr "auf [Präp.]" |          |
| ḥr-ꜣt⸗ "auf [Präp.]" | 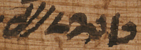 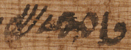 |
| Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) "Horus, Sohn der Isis [GN]" |    |
| Ḥr-šf "Herischef [GN]" |      |
| ḥrỉ "oben [Adverb]" |    |
| ḥrỉ "Oberster, Herr, Vorgesetzter" |                                          |
| ḥrḥ "wachen, hüten" |  |
| ḥlly; ḥll "Trübung, Finsternis (?)" | 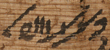  |
| ḥḳr; ḥḳꜣ "hungern" |     |
| ḥtp-nṯr "Gottesopfer" |  |
| ḥḏ "Silber, Geld" |  |
| ḥḏ.t "Weiße Krone" |  |
| ḫꜣ "Meßstab" |   |
| ḫꜣꜥ "werfen, legen, lassen, verlassen" |          |
| ḫꜣsy(.t); ḫꜣs.w(t); ḫꜣs(.wt) "Fremdland, Wüste, Nekropole" |        |
| h̭yh̭e "Staub" |  |
| ḫꜥ "Fest" |  |
| ḫꜥi̯ "erscheinen" |     |
| ḫby "vermindern, abschneiden, rasieren" |  |
| ḫpr "geschehen" |                                                  |
| ḫpr "es ist so (dass), denn, weil [Konjunktion]" |        |
| ḫpš; ḫbš "Sichelschwert" |    |
| ḫm.w "klein, jung [Adjektiv]" |  |
| ḫm-ẖr.w; ḫm-ẖr(.w) "Knabe, junger Mensch, Bursche, Kind" | 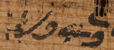 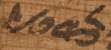   |
| Ḫmnw "Hermopolis [ON]" |  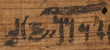 |
| ḫnṱ "stromauf fahren" |   |
| ḫr "[Präfix des Aorists]" |     |
| ḫrw "Stimme" |  |
| ḫt(.w) "Holz, Bäume" |   |
| ẖꜣ(.t) "Gemetzel" |     |
| ẖꜥ.t "Ende" |  |
| ẖn; ẖn⸗ "in [Präp.]" | 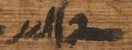       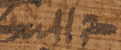 |
| H̱nm "Chnum [GN]" | 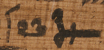  |
| ẖr "Syrer" |   |
| ẖr; ẖr.r.ḥr⸗ "unter, wegen [Präp.]" |   |
| ẖr.t "Speise, Nahrung" |  |
| ẖr-nṯr "Steinmetz" |   |
| ẖrꜣ(.t) "Gewand, Riemen" | 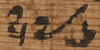 |
| ẖry.w; ẖry "Straße, Weg" |  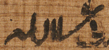 |
| ẖry.t "Witwe" |  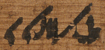 |
| s; st "[enklit. Pron. 3. sg. m.]" |          |
| s.t "Platz, Ort" |  |
| sꜣ "Phyle" |    |
| sỉ-n-ꜥḳ "Bäcker" |   |
| sꜥnḫ "ernähren, leben lassen" |  |
| sw "Monatstag" |            |
| sw-10 "Dekade" |    |
| swr "trinken" |  |
| sbꜣ.w "Tür" |   |
| sbḳ(.w) "klein, gering [Adjektiv]" |  |
| sbt "herrichten, ausrüsten, vorbereiten, versorgen" |  |
| sp "Rest" |    |
| sp "Fall, Angelegenheit, Mal" |  |
| sp-2 "zweimal [Wiederholungszeichen]" |   |
| sf "gestern [Adverb]" |   |
| s[fy] "Messer, Schwert" |  |
| smn "aufsetzen, feststellen, dauern (lassen)" |  |
| smḥ (?) "links" |    |
| smt; [s]mt "Art, Weise, Gestalt" |     |
| sn.w "Bruder" |  |
| ⸢s⸣nty "sich fürchten" |  |
| sḥm.t "Frau" |  |
| sḥn "Krone, Diadem" |   |
| sḥn "Angelegenheit, Amt, Befehl, Auftrag" |  |
| sḥn.ṱ; sḥn "befehlen, beauftragen" |   |
| sḫ(.t) "Feld" |  |
| sẖꜣ "schreiben" |   |
| ssw; ss.w; ⸢ss.w⸣ "Termin, Zeit" |             |
| sḳꜣ "zusammenfügen, sammeln" |  |
| sgrꜣ.w "Herde (o.ä.)" |  |
| st "[enklit. Pron. 3. pl. c.]" |  |
| stbḥ(.t) "Gerät, Waffe" |  |
| stbḥ(.t)-n-ḳnḳn "Kampfgerät, Waffen" |  |
| sṯꜣ.ṱ "(sich) zurückziehen, wenden" |  |
| sdb "essen" |  |
| šy(.w) "See" |  |
| šw "Wert, Nutzen" |  |
| šbi̯.t "Veränderung, Tausch, Entgelt" |   |
| ⸢šm⸣; šm "gehen" |               |
| šm.w "Gang, Reise" |  |
| šmsi̯(?); šmsi̯ "folgen, dienen, geleiten" |     |
| šn "Krankheit" |  |
| šn.w "Inspektion, Untersuchung" |  |
| šni̯ "fragen, suchen, untersuchen" |       |
| šni̯ "krank sein" |  |
| šnꜥ "abweisen, abhalten" |  |
| šnt(.t); ⸢šnt(.t)⸣ "Schurz, Tuch" |   |
| šrỉ "Sohn" |        |
| šll "beten, flehen" | 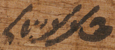 |
| šlly "Wehruf, Wehklage" | 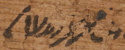 |
| šsp; ⸢šsp⸣ "empfangen" |      |
| ḳb "verdoppeln" |  |
| ḳbꜣ(.t) "Gefäß, Krug" |  |
| ḳn "Stärke, Sieg" |  |
| ḳnḥ.t "Schrein, Naos" | 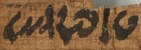 |
| ḳnḳn "schlagen, kämpfen" |   |
| ḳlꜣ.t; ḳlꜣ.w(t) "Riegel, Zapfen" |   |
| ḳdy "umherziehen" |  |
| k.ṱ.t "andere [sg. f.]" |   |
| kꜣm "Garten" | 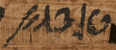 |
| kꜣmy "Gärtner, Winzer" |  |
| kỉỉ.w "anderer [sg. m.]" |  |
| Km "Ägypten" |                |
| gbꜣ.t "Sproß, Blatt, Nachkommenschaft" | 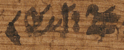 |
| gby.w "Schwacher" |  |
| gmi̯ "finden" |       |
| grp "öffnen, enthüllen, offenbaren" |  |
| gsgs "tanzen" |  |
| gst "Palette" |   |
| gḏwḏꜣ "Mensch aus Gaza, Diener" | 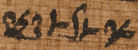 |
| tꜣ "Land, Welt, Erde" |     |
| tꜣ; ⸢tꜣ⸣ "die [def. Artikel sg. f.]" |                                                     |
| Tꜣ-Mḥy "Unterägypten" |  |
| Tꜣ-Šmꜥ "Oberägypten [ON]" |   |
| tꜣỉ "[Kopula sg. f.]" |        |
| tꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| tꜣy⸗f "seine" |     |
| tꜣy⸗s "ihre" |    |
| tꜣy⸗k "deine" |     |
| ta "die von" |  |
| Ta-bꜣ.ỉyi̯ "Tabis(?)" | 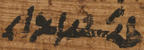 |
| tw⸗ỉ "[proklit. Pron. 1. sg. c.]" |   |
| tw⸗n "[proklit. Pron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸢tw⸣⸗tn "[proklit. Pron. 2. pl. c.]" |  |
| twꜣ "Berg" |  |
| twtw "sammeln, sich versammeln" |  |
| tp.t; tp "erster [Adjektiv]" |   |
| tpy.t "Anfang" | 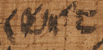 |
| tfy "wegnehmen, entfernen" |  |
| tm "[Negationsverb]" |    |
| tm-hp "Unrecht" |  |
| ṱrry "Ofen" |  |
| tḥ⸢ꜣ⸣ "Bitternis, Leiden, Krankheit" |  |
| tḥꜣ "betrübt sein, bitter sein, krank sein" |  |
| ṱḥs "salben" | 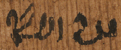 |
| tḫ(?)s(.t) "?" |  |
| ṱkn "nahe kommen, eilen" |   |
| ṯꜣi̯ "nehmen, empfangen" |     |
| dp-n-ỉꜣw.w(t) "Vieh" |  |
| Dpꜣy; Dpꜣ; Dpyꜣ "Dep (Stadtteil von Buto) [ON]" |    |
| dmḏ "Summe" |         |
| dnỉ(.t) "Anteil" |  |
| dšry(.t) "Rote Krone" |  |
| ḏꜣḏꜣ "Kopf" |     |
| ḏi̯; ḏi̯.t; ḏi̯⸗ "geben" |                                            |
| ḏm "Geschlecht, Nachkomme, Generation; Jungmannschaft; Kalb" |  |
| ḏmꜥy "trauern, klagen" | 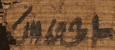 |
| ḏn⸢f⸣; ḏnf "Gewicht, Maß, Gleichgewicht" |   |
| ḏr(.t); ḏr(.t)⸗ "Hand" |    |
| ḏr⸗ "ganz, alle" |   |
| ḏrꜣ; ḏ⸢r⸣ꜣ "stark, siegreich sein [Adjektivverb]" |     |
| ḏlḏ "Pflanzung, Hecke (?)" |   |
| Ḏḥw.tỉ "Thot [GN]" |   |
| Ḏd "Djed-Pfeiler" |   |
| ḏd; ⸢ḏd⸣ "[Konjunktion]" |                                                                                                 |
| ḏd.ṱ; ḏd; (r:)ḏd "sagen, sprechen" |                              |
| Ḏd-ḥr "Tachos, Taos [KN]" | 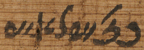 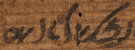 |
| 1; (sw)-1 "Tag 1" |     |
| 10 "10" |  |
| 13 "13" |  |
| 16 "16" |   |
| 18 "18" |   |
| 19 "19" | 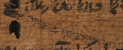 |
| 2 "(Tag) 2" |  |
| 2.nw; {2.nw} "zweiter" |   |
| 3 "(Tag) 3" |  |
| 3; 3.t "3" |       |
| 4 "(Tag) 4" |  |
| 5 "(Tag) 5" |  |
| 5.t "5" |   |
| 6 "(Tag) 6" |  |
| 6 "6" |   |
| 7 "7" |  |
| 7; (sw)-7 "(Tag) 7" |   |
| :**𓅓1𓄿1** | :𓅓𓄿 |  |
| :𓎆 | :𓎆 |    |
| :𓏾 | :𓏾 |  |
| :𓐀 | :𓐀 |  |
| :𓐂 | :𓐂 |  |
| 𓀀3 | 𓀀 |   |
| 𓀀:𓈖 |   | |
| 𓀁 | 𓀁 |                                                                                       |
| 𓀁1 | 𓀁 |  |
| 𓀁° | 𓀁 |                            |
| 𓀎 | 𓀎 |   |
| 𓀎𓏰:𓀀𓀁 | 𓀎 |   |
| 𓀐 | 𓀐 |                                                  |
| 𓀐1 | 𓀐 |   |
| 𓀔 | 𓀔 |                         |
| 𓀗 | 𓀗 |      |
| 𓀢2 | 𓀢 |  |
| 𓀨 | 𓀨 |   |
| 𓀹1 | 𓀹 |  |
| 𓀼 | 𓀼 |   |
| 𓁐9 | 𓁐 |  |
| 𓁗1 | 𓁗 |   |
| 𓁗1:° | 𓁗 |  |
| 𓁶𓏤1 | 𓁶𓏤 |      |
| 𓁶𓏤1𓊪1 | 𓁶𓏤𓊪 |  |
| 𓁶𓏤1𓊪1:° | 𓁶𓏤𓊪 |    |
| 𓁷𓏤 | 𓁷𓏤 |                        |
| 𓁷𓏤1𓀀3 | 𓁷𓏤𓀀 |   |
| 𓁹:𓂋*𓏭 |                                                                                     | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑 |                 | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑1 |    | |
| 𓁹:𓏏*𓏤𓁻1 |   | |
| 𓁻2 | 𓁻 |  |
| 𓁻:° | 𓁻 |           |
| 𓂊2:° | 𓂊 |   |
| 𓂋 | 𓂋 |                |
| 𓂋1 | 𓂋 |                                                                                       |
| 𓂋1𓂋:𓆑 | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓎡° | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓏥𓏲 | 𓂋 |     |
| 𓂋3𓌥 | 𓂋𓌥 |       |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1'𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲 |   |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲𓏲 |     |
| 𓂋:𓂋 |    | |
| 𓂋:𓂧 |      | |
| 𓂋:𓂧:° |  | |
| 𓂋:𓂧:°𓌗1 |  | |
| 𓂋:𓂧@ |   | |
| 𓂋:𓂧@𓂾𓂾 |   | |
| 𓂋:𓂧𓂾𓂾 |  | |
| 𓂋:𓂧𓌗1 |    | |
| 𓂋:𓂧𓌗2 |  | |
| 𓂋:𓆑 |  | |
| 𓂋:𓊪 |     | |
| 𓂋:𓍿𓀀𓏪 |            | |
| 𓂋:𓎡 |  | |
| 𓂋:𓎡° |  | |
| 𓂋:𓏏*𓏰 |            | |
| 𓂋:𓏥𓏲 |     | |
| 𓂋:𓐍 |   | |
| 𓂋:𓐍@1 |  | |
| 𓂓𓏤1 | 𓂓𓏤 |  |
| 𓂓𓏤2 | 𓂓𓏤 |   |
| 𓂚3 | 𓂚 |  |
| 𓂚3𓍘𓇋4 | 𓂚𓍘𓇋 |  |
| 𓂜1 | 𓂜 |  |
| 𓂜1:𓅪 |  | |
| 𓂝 | 𓂝 |          |
| 𓂝:𓂝:° |  | |
| 𓂝:𓂝:°𓏤 |  | |
| 𓂝:𓂝𓏤 |  | |
| 𓂝:𓂻 |         | |
| 𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥 |       | |
| 𓂝:𓈖 |  | |
| 𓂝:𓈖:° |  | |
| 𓂝:𓈖𓏌𓏲1 |  | |
| 𓂝:𓈙𓀞2 |    | |
| 𓂞:𓏏2 |          | |
| 𓂞:𓏏3 |                    | |
| 𓂞:𓏏3 𓏞𓍼:𓏤@ |  | |
| 𓂞:𓏏6 |                 | |
| 𓂞:𓏏6𓏲 |                 | |
| 𓂧 | 𓂧 |   |
| 𓂧':𓏭 |               | |
| 𓂧:𓏏*𓏤 |            | |
| 𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 |   |
| 𓂷:𓂡1 |     | |
| 𓂷:𓂡1:° |  | |
| 𓂸:𓏏 |   | |
| 𓂸:𓏏𓂭𓂭 |   | |
| 𓂺1 | 𓂺 |  |
| 𓂻 | 𓂻 |                   |
| 𓂻1:° | 𓂻 |  |
| 𓂻:° | 𓂻 |                                  |
| 𓂼 | 𓂼 |   |
| 𓂼1 | 𓂼 |  |
| 𓂼2 | 𓂼 |  |
| 𓂼2𓂼1 | 𓂼𓂼 |  |
| 𓂼𓏲1𓂼 | 𓂼𓏲𓂼 |  |
| 𓂽 | 𓂽 |  |
| 𓂽1 | 𓂽 |    |
| 𓂽:° | 𓂽 |  |
| 𓂾𓂾 | 𓂾𓂾 |    |
| 𓃀 | 𓃀 |   |
| 𓃀3𓏲1 | 𓃀𓏲 |          |
| 𓃀4𓏲4 | 𓃀𓏲 |    |
| 𓃀:𓈖1 |                   | |
| 𓃀:𓈖1:° |         | |
| 𓃀:𓈖1:°𓊪:𓏭2 |  | |
| 𓃀:𓈖1𓊪:𓏭2 |            | |
| 𓃀𓏲1 | 𓃀𓏲 |                  |
| **𓃀𓏲1𓅃𓅆'**:𓎡1 |  | |
| 𓃂 | 𓃂 |                 |
| 𓃂𓈘:𓈇 | 𓃂 |    |
| 𓃂𓈘:𓈇:° | 𓃂 |              |
| 𓃛 | 𓃛 |     |
| 𓃛𓃛 | 𓃛𓃛 |   |
| 𓃭 | 𓃭 |                                              |
| 𓃭𓏤 | 𓃭𓏤 |                      |
| 𓃹:𓈖 |     | |
| 𓃹:𓈖2 |            | |
| 𓄂:𓏏*𓏤 |            | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1𓄣𓏤 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤 |   | |
| 𓄋:𓊪1 |   | |
| 𓄋:𓊪@ |      | |
| 𓄋:𓊪@𓏲𓏭:𓏛 |     | |
| 𓄑:𓏛1 |                       | |
| 𓄑:𓏛@ |   | |
| 𓄕 | 𓄕 |  |
| 𓄕𓅓𓏭:𓏛 | 𓄕𓅓 |  |
| 𓄖:𓂻 |       | |
| 𓄛1 | 𓄛 |    |
| 𓄛2 | 𓄛 |  |
| 𓄟1 | 𓄟 |   |
| 𓄡:𓏏*𓏤 |    | |
| 𓄡:𓏏*𓏤@ |  | |
| 𓄣1𓏤1 | 𓄣𓏤 |  |
| 𓄣𓏤 | 𓄣𓏤 |        |
| 𓄤 | 𓄤 |        |
| 𓄤𓏭:𓏛 | 𓄤 |        |
| 𓄧 | 𓄧 |   |
| 𓄹:𓏭 |                                       | |
| 𓄹:𓏭1 |  | |
| 𓄿 | 𓄿 |       |
| 𓄿1 | 𓄿 |                                                         |
| 𓄿:° | 𓄿 |         |
| 𓄿:°𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓄿𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓅃𓅆 | 𓅃𓅆 |     |
| 𓅆 | 𓅆 |                                                                                            |
| 𓅆@ | 𓅆 |      |
| 𓅆@° | 𓅆 |   |
| 𓅆° | 𓅆 |      |
| 𓅐 | 𓅐 |      |
| 𓅐𓏏:𓆇 | 𓅐 |    |
| 𓅐𓏲2𓏏:𓆇 | 𓅐𓏲 |  |
| 𓅓 | 𓅓 |                                                        |
| 𓅓'𓎔 | 𓅓𓎔 |  |
| 𓅓1 | 𓅓 |                                                                     |
| 𓅓1𓄿1 | 𓅓𓄿 |  |
| 𓅓1𓅐𓏏:𓆇 | 𓅓𓅐 |  |
| 𓅓1𓈖:𓏥 | 𓅓 |  |
| 𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓅓𓐠𓏤 |                      |
| 𓅓:𓏏 |   | |
| 𓅓:𓏏𓀐 |   | |
| 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 | 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 |  |
| 𓅓𓎔 | 𓅓𓎔 |        |
| 𓅓𓏭 | 𓅓𓏭 |    |
| 𓅓𓏭:𓏛 | 𓅓 |      |
| 𓅓𓏭:𓏛@ | 𓅓 |       |
| 𓅝:𓏏*𓏭 |   | |
| 𓅝:𓏏*𓏭𓅆 |   | |
| 𓅠 | 𓅠 |       |
| 𓅠𓏭:𓏛 | 𓅠 |       |
| 𓅡◳𓏤 |                      | |
| 𓅨:𓂋*𓏰 |     | |
| 𓅪 | 𓅪 |       |
| 𓅪:° | 𓅪 |      |
| 𓅯𓄿 | 𓅯𓄿 |                                                                                                                                                       |
| 𓅯𓄿3 | 𓅯𓄿 |  |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓅯𓄿𓇋𓇋 |     |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 | 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 |                                 |
| 𓅯𓄿𓏭1 | 𓅯𓄿𓏭 |                                        |
| 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 | 𓅯𓄿𓏲 |   |
| 𓅱 | 𓅱 |        |
| 𓅱𓃀4𓏲4 | 𓅱𓃀𓏲 |    |
| 𓆄 | 𓆄 |   |
| 𓆇:𓏤 |    | |
| 𓆈:𓏥 |    | |
| 𓆊 | 𓆊 |        |
| 𓆎 | 𓆎 |  |
| 𓆎@2 | 𓆎 |                     |
| 𓆎@2𓅓1 | 𓆎𓅓 |               |
| 𓆎@2𓅓𓏭:𓏛 | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆎@2𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |      |
| 𓆎𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆑 | 𓆑 |                                                                                                                               |
| 𓆑1 | 𓆑 |          |
| 𓆑1𓅆 | 𓆑𓅆 |        |
| 𓆑4 | 𓆑 |     |
| 𓆑:𓏭 |   | |
| 𓆓:𓂧 |                                                                                                                                   | |
| 𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3 |   | |
| 𓆙 | 𓆙 |             |
| 𓆛:𓈖 |    | |
| 𓆣:𓂋𓏲 |                                                         | |
| 𓆤1 | 𓆤 |   |
| 𓆤1:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓆮 | 𓆮 |      |
| 𓆰:𓈖𓏪:° |       | |
| 𓆰𓏪 | 𓆰𓏪 |      |
| 𓆰𓏪@1 | 𓆰𓏪 |    |
| 𓆱:𓏏*𓏤 |                      | |
| 𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥:° |   | |
| 𓆱:𓏥:° |   | |
| 𓆳 | 𓆳 |           |
| 𓆳𓏏:𓊗3 | 𓆳 |      |
| 𓆳𓏤𓏰:𓇳5 | 𓆳𓏤 |           |
| 𓆷 | 𓆷 |     |
| 𓆷1 | 𓆷 |     |
| 𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳1 | 𓆷𓏰𓏰 |     |
| 𓆸 | 𓆸 |      |
| 𓆼 | 𓆼 |               |
| 𓆼1 | 𓆼 |        |
| 𓆼𓄿3 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿3𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿5 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿5𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿𓂝:𓂻1 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓇇 | 𓇇 |  |
| 𓇋 | 𓇋 |  |
| 𓇋1 | 𓇋 |          |
| 𓇋1𓇋𓀀 | 𓇋𓇋𓀀 |  |
| 𓇋1𓏏:𓆑 | 𓇋 |    |
| 𓇋2 | 𓇋 |            |
| 𓇋2𓂋:𓊪 | 𓇋 |   |
| 𓇋2𓆛:𓈖 | 𓇋 |    |
| 𓇋5 | 𓇋 |         |
| 𓇋5:𓎡 |         | |
| 𓇋𓀁 | 𓇋𓀁 |             |
| 𓇋𓀁1 | 𓇋𓀁 |                                      |
| 𓇋𓀁1𓋴𓏏 | 𓇋𓀁𓋴𓏏 |   |
| 𓇋𓀁𓂋:𓎡 | 𓇋𓀁 |  |
| 𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤 | 𓇋𓀁 |            |
| 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛 | 𓇋𓀁𓏤 |       |
| 𓇋𓂋:𓏭 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓂋:𓏭𓀹1 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓇋 | 𓇋𓇋 |             |
| 𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓇋𓇋 |          |
| 𓇋𓇋𓆑 | 𓇋𓇋𓆑 |    |
| 𓇋𓇋𓏲 | 𓇋𓇋𓏲 |                                                                                                                                |
| 𓇋𓈖 | 𓇋𓈖 |       |
| 𓇋𓋴𓏏 | 𓇋𓋴𓏏 |                        |
| 𓇋𓎛𓃒 | 𓇋𓎛𓃒 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖 | 𓇋 |     |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆 | 𓇋 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆° | 𓇋 |  |
| 𓇋𓏲 | 𓇋𓏲 |                                                                                                                              |
| 𓇋𓏲 𓏪3 | 𓇋𓏲 𓏪 |  |
| 𓇋𓏲𓆑 | 𓇋𓏲𓆑 |                        |
| 𓇋𓏲𓏪 | 𓇋𓏲𓏪 |   |
| 𓇍1𓇋1 | 𓇍𓇋 |             |
| 𓇍1𓇋1𓂻 | 𓇍𓇋𓂻 |             |
| 𓇏:° | 𓇏 |  |
| 𓇓1 | 𓇓 |                   |
| 𓇓1𓅆 | 𓇓𓅆 |          |
| 𓇘 | 𓇘 |   |
| 𓇘:𓏏*𓏰𓅓 |   | |
| 𓇛1 | 𓇛 |   |
| 𓇣𓂧:𓏏*𓏰𓌽:𓏥1 | 𓇣 |   |
| 𓇥:𓂋1 |       | |
| 𓇥:𓂋1𓏭:𓏛 |   | |
| 𓇥:𓂋1𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2 |   | |
| 𓇥:𓂋2𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇯 | 𓇯 |                                              |
| 𓇳 | 𓇳 |                            |
| 𓇳𓅆 | 𓇳𓅆 |      |
| 𓇳𓍼:𓏤 | 𓇳 |     |
| 𓇳𓍼:𓏤° | 𓇳 |  |
| 𓇳𓏤 | 𓇳𓏤 |   |
| 𓇹 | 𓇹 |   |
| 𓇹:𓇼 |   | |
| 𓇹:𓇼:𓇳 |   | |
| 𓇺:𓏺 |  | |
| 𓇺:𓏺1 |  | |
| 𓇺:𓏻1 |     | |
| 𓇺:𓏼@ |        | |
| 𓇺:𓏽@ |   | |
| 𓇾:𓏤@ |    | |
| 𓇾:𓏤𓈇@ |   | |
| 𓈉2 | 𓈉 |        |
| 𓈉2:𓏏*𓏤 |        | |
| 𓈌 | 𓈌 |   |
| 𓈌:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓈍:𓂝*𓏛 |      | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆 |    | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆° |  | |
| 𓈎 | 𓈎 |                |
| 𓈎:° | 𓈎 |  |
| 𓈎:𓈖 |     | |
| 𓈎:𓈖@ |    | |
| 𓈎:𓈖@𓏌𓏲1 |  | |
| 𓈎:𓈖𓏌𓏲1 |   | |
| 𓈐':𓏏*𓏤 |  | |
| 𓈐:𓂻 |     | |
| 𓈐:𓂻@ |   | |
| 𓈒 | 𓈒 |  |
| 𓈒:𓏥 |  | |
| 𓈒:𓏥1 |   | |
| 𓈔 | 𓈔 |   |
| 𓈖 | 𓈖 |                                                                    |
| 𓈖1 | 𓈖 |                   |
| 𓈖1:**𓄿1'𓇋𓇋𓏲** |   | |
| 𓈖1:**𓇛1𓅓1** |   | |
| 𓈖2 | 𓈖 |                                       |
| 𓈖2:𓄿1𓇋𓇋 |   | |
| 𓈖2:𓌳° |  | |
| 𓈖:𓀀° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖 |           | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁 |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁 |          | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁° |  | |
| 𓈖:𓄿 |                                                                                                       | |
| 𓈖:𓄿° |                  | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |  | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑 |  | |
| 𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4 |       | |
| 𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥 |   | |
| 𓈖:𓈖9 |   | |
| 𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 |       | |
| 𓈖:𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖:**𓋴𓆰:𓈖𓏪:°** |       | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲 |       | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1 |     | |
| 𓈖:𓎡2 |  | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 |    | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 |    | |
| 𓈖:𓏌*𓏲 |                 | |
| 𓈖:𓏏 |  | |
| 𓈖:𓏏*𓏭1 |                                                                                  | |
| 𓈖:𓏥 |      | |
| 𓈖:𓏲*𓏥 |      | |
| 𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 | 𓈖𓇋𓅓 |                         |
| 𓈗 | 𓈗 |         |
| 𓈗𓈘:𓈇 | 𓈗 |         |
| 𓈘:𓈇 |             | |
| 𓈘:𓈇:° |              | |
| 𓈙 | 𓈙 |                 |
| 𓈝 | 𓈝 |                |
| 𓈝𓂻:° | 𓈝𓂻 |                |
| 𓉐2 | 𓉐 |   |
| 𓉐:𓉻 |                     | |
| 𓉐:𓉻𓅆 |                     | |
| 𓉐𓏤 | 𓉐𓏤 |                               |
| 𓉐𓏤1 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@1 | 𓉐𓏤 |                                 |
| 𓉐𓏤@2 | 𓉐𓏤 |    |
| 𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |            |
| 𓉔 | 𓉔 |                                    |
| 𓉔1 | 𓉔 |    |
| 𓉗1 | 𓉗 |                       |
| 𓉗1𓉐𓏤@1 | 𓉗𓉐𓏤 |                 |
| 𓉞 | 𓉞 |   |
| 𓉺1 | 𓉺 |  |
| 𓉺1:𓏏*𓏰𓏌 |  | |
| 𓉻 | 𓉻 |    |
| 𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 |    | |
| 𓉻:𓂝*𓏛 |                                                    | |
| 𓉿:𓂡1 |            | |
| 𓊃 | 𓊃 |       |
| 𓊃:𓀀:𓈖 |   | |
| 𓊃:𓈞𓁐2 |  | |
| 𓊌1 | 𓊌 |         |
| 𓊏 | 𓊏 |      |
| 𓊏𓏭:𓏛 | 𓊏 |      |
| 𓊑1 | 𓊑 |     |
| 𓊖 | 𓊖 |  |
| 𓊗:𓏻1 |   | |
| 𓊡 | 𓊡 |    |
| 𓊡𓏭:𓏛 | 𓊡 |  |
| 𓊡𓏲𓏭:𓏛 | 𓊡𓏲 |   |
| 𓊢𓂝:𓂻 | 𓊢 |     |
| 𓊤 | 𓊤 |  |
| 𓊤𓏲 | 𓊤𓏲 |  |
| 𓊨 | 𓊨 |    |
| 𓊨:° | 𓊨 |   |
| 𓊨:°𓏤𓉐𓏤 | 𓊨𓏤𓉐𓏤 |  |
| 𓊨𓏏:𓆇1 | 𓊨 |    |
| 𓊪 | 𓊪 |          |
| 𓊪1 | 𓊪 |                     |
| 𓊪1:° | 𓊪 |     |
| 𓊪1:𓉐𓏤1 |   | |
| 𓊪:° | 𓊪 |    |
| 𓊪:𓏏𓎛 |    | |
| 𓊪:𓏏𓎛𓅆 |    | |
| 𓊪:𓏭 |       | |
| 𓊪:𓏭2 |             | |
| 𓊮 | 𓊮 |  |
| 𓊵:𓏏@1 |  | |
| 𓊹 | 𓊹 |         |
| 𓊹𓅆 | 𓊹𓅆 |    |
| 𓊹𓅆° | 𓊹𓅆 |   |
| 𓊹𓊹𓊹1 | 𓊹𓊹𓊹 |      |
| 𓊹𓍛𓏤:𓀀 | 𓊹𓍛 |     |
| 𓊽 | 𓊽 |   |
| 𓊽1 | 𓊽 |   |
| 𓊽1𓊽1 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓊽𓊽 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓋀 | 𓋀 |     |
| 𓋀𓏤 | 𓋀𓏤 |    |
| 𓋀𓏤𓏰:𓊖3 | 𓋀𓏤 |  |
| 𓋁𓃀1 | 𓋁𓃀 |  |
| 𓋁𓃀1𓏤𓊖 | 𓋁𓃀𓏤𓊖 |  |
| 𓋞:𓈒*𓏥1 |   | |
| 𓋩1 | 𓋩 |   |
| 𓋩2 | 𓋩 |  |
| 𓋴 | 𓋴 |                                                   |
| 𓋴@𓏤 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴@𓏤𓄹:𓏭 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴𓇋1𓅨:𓂋*𓏰 | 𓋴𓇋 |  |
| 𓋴𓏏 | 𓋴𓏏 |                                                      |
| 𓋴𓏏1𓏏 | 𓋴𓏏𓏏 |   |
| 𓋹𓈖:𓐍 | 𓋹 |         |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |          |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏2 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |                           |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏4 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |       |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰 | 𓌃 |         |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁 | 𓌃 |     |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁° | 𓌃 |     |
| 𓌉 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥1 | 𓌉 |   |
| 𓌗1 | 𓌗 |     |
| 𓌗2 | 𓌗 |  |
| 𓌙:𓈉 |                   | |
| 𓌙:𓈉1 |       | |
| 𓌞:𓊃 |   | |
| 𓌞:𓊃1 |   | |
| 𓌞:𓊃1𓂻:° |   | |
| 𓌞:𓊃𓇋𓏲𓂻 |   | |
| 𓌡:𓂝*𓏤3 |   | |
| 𓌢° | 𓌢 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌨:𓂋𓏭:𓏛 |     | |
| 𓌪:𓂡 |      | |
| 𓌳° | 𓌳 |  |
| 𓌶:𓂝2 |   | |
| 𓌶:𓂝2𓆄 |   | |
| 𓌻 | 𓌻 |     |
| 𓌻𓀁 | 𓌻𓀁 |  |
| 𓌻𓏭:𓏛1𓀁 | 𓌻 |    |
| 𓍃 | 𓍃 |    |
| 𓍃𓅓𓏭:𓏛 | 𓍃𓅓 |    |
| 𓍊𓏤 | 𓍊𓏤 |     |
| 𓍑 | 𓍑 |                    |
| 𓍑𓄿3 | 𓍑𓄿 |      |
| 𓍑𓍑 | 𓍑𓍑 |     |
| 𓍘 | 𓍘 |  |
| 𓍘1 | 𓍘 |              |
| 𓍘1𓎟:𓏏1 | 𓍘 |        |
| 𓍘𓇋2 | 𓍘𓇋 |    |
| 𓍘𓇋4 | 𓍘𓇋 |     |
| 𓍘𓈖:𓏏 | 𓍘 |  |
| 𓍘𓈖:𓏏1 | 𓍘 |  |
| 𓍬:𓂻':° |  | |
| 𓍯 | 𓍯 |                               |
| 𓍱 | 𓍱 |    |
| 𓍱1 | 𓍱 |  |
| 𓍱:𓂡1 |  | |
| 𓍱:𓂡1𓏏 |  | |
| 𓍴 | 𓍴 |       |
| 𓍴1 | 𓍴 |  |
| 𓍴1𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖9 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |       |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2 | 𓍴 |    |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓋩2 | 𓍴 |  |
| 𓍸𓏛1 | 𓍸𓏛 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |                                      |
| 𓍺 | 𓍺 |                              |
| 𓍼:𓏤1 |   | |
| 𓍼:𓏥 |  | |
| 𓎃° | 𓎃 |    |
| 𓎆 | 𓎆 |             |
| 𓎇 | 𓎇 |  |
| 𓎉 | 𓎉 |   |
| 𓎔 | 𓎔 |  |
| 𓎔2 | 𓎔 |                |
| 𓎔2: | 𓎔: |          |
| 𓎔:𓏺 |   | |
| 𓎔:𓏻 |      | |
| 𓎔:𓏼 |      | |
| 𓎔:𓏽 |    | |
| 𓎛 | 𓎛 |     |
| 𓎛1 | 𓎛 |  |
| 𓎛2 | 𓎛 |        |
| 𓎛2𓐑:𓊪𓏲1 | 𓎛 |        |
| 𓎛𓂝:𓏏𓄹 | 𓎛 |   |
| 𓎛𓈖:𓂝 | 𓎛 |  |
| 𓎝𓎛 | 𓎝𓎛 |  |
| 𓎟:𓏏 |        | |
| 𓎟:𓏏1 |   | |
| 𓎡 | 𓎡 |                   |
| 𓎡1 | 𓎡 |          |
| 𓎡1:𓇋1𓇋𓀀 |  | |
| 𓎡:𓍘𓇋 |   | |
| 𓎨 | 𓎨 |   |
| 𓎭 | 𓎭 |    |
| 𓎱1 | 𓎱 |    |
| 𓎱1:𓇳 |    | |
| 𓎸 | 𓎸 |   |
| 𓎸1 | 𓎸 |  |
| 𓎸𓅓𓏰:𓇳1 | 𓎸𓅓 |   |
| 𓎼 | 𓎼 |             |
| 𓏇1 | 𓏇 |   |
| 𓏇1𓇋1 | 𓏇𓇋 |   |
| 𓏌 | 𓏌 |       |
| 𓏌:𓈖 |       | |
| 𓏌:𓈖:° |     | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤 |    | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤@1 |  | |
| 𓏌:𓈖𓏤1𓉐𓏤@1 |   | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤 |   | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤@1 |   | |
| 𓏌𓏲1 | 𓏌𓏲 |           |
| 𓏌𓏲2 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏌𓏲𓍖:𓏛 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏎:𓈖 |       | |
| 𓏎:𓈖𓏤 |     | |
| 𓏏 | 𓏏 |                                                                              |
| 𓏏*𓏤 | 𓏏𓏤 |        |
| 𓏏*𓏰 | 𓏏𓏰 |        |
| 𓏏1 | 𓏏 |                 |
| 𓏏1:° | 𓏏 |  |
| 𓏏:° | 𓏏 |   |
| 𓏏:𓄿 |                                                                 | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |     | |
| 𓏏:𓄿𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑 |    | |
| 𓏏:𓄿𓏭 |        | |
| 𓏏:𓆇 |         | |
| 𓏏:𓆇1 |   | |
| 𓏏:𓆑 |    | |
| 𓏏:𓈇𓏤@1 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥:° |    | |
| 𓏏:𓈙 |   | |
| 𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖1 |  | |
| 𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖3 |  | |
| 𓏛 | 𓏛 |    |
| 𓏛𓏏 | 𓏛𓏏 |  |
| 𓏞𓍼:𓏤 | 𓏞 |    |
| 𓏞𓍼:𓏤@ | 𓏞 |         |
| 𓏠:𓈖 |          | |
| 𓏠:𓈖1 |   | |
| 𓏠:𓈖1:° |   | |
| 𓏠:𓈖1:°𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |   | |
| 𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛 |  | |
| 𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |  | |
| 𓏠:𓈖𓐍:𓍊𓏤 |  | |
| 𓏤 | 𓏤 |                                      |
| 𓏤1 | 𓏤 |   |
| 𓏤1𓈘:𓈇 | 𓏤 |  |
| 𓏤𓊖 | 𓏤𓊖 |   |
| 𓏤𓏰:𓇳5 | 𓏤 |           |
| 𓏤𓏰:𓊖1 | 𓏤 |   |
| 𓏤𓏰:𓊖3 | 𓏤 |                       |
| 𓏥 | 𓏥 |    |
| 𓏪 | 𓏪 |                                                                                                                               |
| 𓏪1 | 𓏪 |                                                 |
| 𓏪1° | 𓏪 |   |
| 𓏪3 | 𓏪 |                                     |
| 𓏫 | 𓏫 |   |
| 𓏫1:° | 𓏫 |   |
| 𓏫:° | 𓏫 |   |
| 𓏭:𓂢 |     | |
| 𓏭:𓏛 |                                                | |
| 𓏭:𓏛1 |                       | |
| 𓏰:𓀀 |   | |
| 𓏰:𓇳1 |                | |
| 𓏰:𓇳1@ |           | |
| 𓏰:𓇳2𓏤2 |       | |
| 𓏰:𓊖2° |    | |
| 𓏲 | 𓏲 |                  |
| 𓏲1 | 𓏲 |        |
| 𓏲2 | 𓏲 |   |
| 𓏲:𓏏 |                  | |
| 𓏲:𓏏𓏤 |      | |
| 𓏲𓏭:𓏛 | 𓏲 |                                         |
| 𓏴:𓂡 |            | |
| 𓏴:𓂡𓍘1 |         | |
| 𓏴:𓏛4 |   | |
| 𓏴:𓏛4𓀁 |   | |
| 𓏶 | 𓏶 |      |
| 𓏶𓅓 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓1 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓𓏭 | 𓏶𓅓𓏭 |    |
| 𓏺 | 𓏺 |      |
| 𓏺:𓏏 |    | |
| 𓏻4 | 𓏻 |  |
| 𓏻:𓏌 |   | |
| 𓏼1 | 𓏼 |          |
| 𓏽1 | 𓏽 |   |
| 𓏾 | 𓏾 |      |
| 𓏾2 | 𓏾 |  |
| 𓏿 | 𓏿 |        |
| 𓐀 | 𓐀 |     |
| 𓐀1 | 𓐀 |  |
| 𓐁 | 𓐁 |     |
| 𓐁1 | 𓐁 |   |
| 𓐁1:𓐋2𓏌𓏲1𓀼 |   | |
| 𓐂 | 𓐂 |    |
| 𓐅 | 𓐅 |  |
| 𓐆 | 𓐆 |  |
| 𓐇 | 𓐇 |  |
| 𓐈1 | 𓐈 |  |
| 𓐉 | 𓐉 |  |
| 𓐊 | 𓐊 |   |
| 𓐋2 | 𓐋 |   |
| 𓐍 | 𓐍 |           |
| 𓐍:𓂋 |     | |
| 𓐍:𓂋𓀁 |     | |
| 𓐍:𓅓 |     | |
| 𓐍:𓅓𓅪 |  | |
| 𓐍:𓅓𓅪:° |    | |
| 𓐍:𓊪2 |   | |
| 𓐍:𓏏*𓏰 |    | |
| 𓐍:𓏭 |        | |
| 𓐑:𓊪 |       | |
| 𓐑:𓊪𓏲1 |  | |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛 | 𓐠𓏤 |       |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓐠𓏤 |                     |
| 𓐪 | 𓐪 |    |
| 𓐪𓂧:𓏏*𓏰 | 𓐪 |  |
| | |    |
| ⸗y "[Suffixpron. 1. sg. c.]" |             |
| ⸗w; [⸗w]; ⸢⸗w⸣; [[⸗w]] "[Suffixpron. 3. pl. c.]" |                                                                                                                    |
| ⸗f; [⸗f]; ⸢⸗f⸣ "[Suffixpron. 3. sg. m.]" |                                                                                                                            |
| ⸗n "[Suffixpron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸗s; ⸢⸗s⸣ "[Suffixpron. 3. sg. f.]" |                                  |
| ⸗k "[Suffixpron. 2. sg. m.]" | 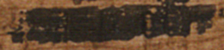       |
| ⸗tn "[Suffixpron. 2. pl. c.]" |    |
| ꜣwy "Lobpreis" |  |
| ꜣbḫ "vergessen" |  |
| ꜣbd "Monat" |   |
| ꜣbd-1 "Monat 1" |   |
| ꜣbd-2 "Monat 2" |     |
| ꜣbd-3; ⸢ꜣbd-3⸣ "Monat 3" |        |
| ꜣbd-4 "Monat 4" |   |
| ꜣbdy "Neulicht, zweiter Tag des Mondmonats" |   |
| ꜣfꜥ(.t); ꜣfꜥ(.w) "gierig [Adjektiv]" |   |
| ꜣrwy "Stengel, Stoppel, Spreu" |   |
| ꜣḥ.w "Acker" |  |
| ꜣḫ(.t) "Überschwemmungsjahreszeit, Achet" |     |
| ꜣs(.t) "Isis [GN]" |   |
| ꜣsḳ "zögern" | 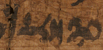 |
| ꜣgy "tüchtig, vorzüglich, vortrefflich" | 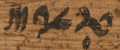 |
| ꜣḏꜣ(.t) "Hacke" | 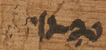 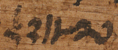 |
| ỉ.ỉr-ḥr; ỉ:ỉr-ḥr "vor, bei, zur Zeit von [Präp.]" |    |
| ỉ.ḳd "Baumeister" |  |
| ỉꜣw.t "Amt, Würde" |    |
| ỉꜣw.t-(n)-ḥrỉ "Herrscheramt" |    |
| ỉꜣb.tỉ "Osten" |  |
| ỉ:ỉri̯ "[Konverter 2. Tempus]" |      |
| ỉ:ỉri̯; (ỉ:)ỉri̯ "[Bildungselement des Partizips]" |                |
| ỉ:ỉri̯⸗f "[Konverter 2. Tempus + Suffixpron. 3. sg. m.]" | 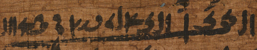   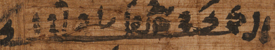      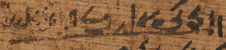 |
| ỉyi̯ "kommen" |            |
| ỉꜥḥ "Mond" |  |
| Ỉꜥḥ-ms "Amasis [KN]" |   |
| ỉw; [ỉw] "[Bildungselement des Futur III]" |                                                     |
| ⸢ỉw⸗w⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. pl. c.]" |   |
| ỉw⸗f "er [proklit. Pron. 3. sg. m.]" |     |
| ỉw⸗f "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗f "wenn er [Konditionalis + Suffixpron. 3. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗f; ỉw⸗f(?) "indem er [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗s "sie [proklit. Pron. 3. sg. f.]" |      |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. f.]" |       |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣; ⸢ỉw⸣⸗s "indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. f.]" |           |
| ỉw⸗k "du [proklit. Pron. 2. sg. m.]" |   |
| ỉw⸗k "indem du [Umstandskonverter + Suffixpron. 2. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗k "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉw⸗k "[Konditionalis + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉwi̯ "kommen" |   |
| ỉwỉw.w; ỉwỉw "Hund" |   |
| Ỉwnw "Heliopolis [ON])" | 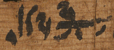 |
| ỉwr "schwanger werden" |  |
| ỉb "Herz" |  |
| ỉbỉ "Honig" |   |
| ỉp "zählen" |   |
| ỉpe.t; ỉpe(.t); ỉp(.t) "Arbeit" |        |
| ỉpre "Sproß, Samen, Korn" |  |
| ỉpt "Tafel" |  |
| ỉmn "Amun [GN]" |   |
| ỉmn.tỉ "Westen" |  |
| Ỉmn-ỉ:ỉri̯-ḏi̯.t-s "Amyrtaios [KN]" | 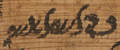  |
| ỉn "[Fragepartikel]" |  |
| ỉn; ⸢ỉn⸣ "[Postnegation]" |     |
| ỉn-nꜣ.w "wenn [Bildungselement Konditionalis]" |  |
| ỉni̯ "holen, bringen" |       |
| ỉne "Stein" |    |
| ỉr.t "Auge" |   |
| ỉrỉ "Gefährte" |  |
| ỉri̯; {ỉri̯}; ỉri̯ (?); ỉ:ỉri̯ "tun, machen" |                                                |
| ỉri̯⸗f "[Verb + Suffixpron. 3. sg. masc.]" |      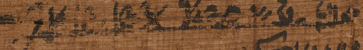   |
| ỉri̯-ḥrỉ "Herrschaft, Regierung" |        |
| ỉri̯-sh̭y "Macht haben über, verfügen über" |  |
| ỉrpy; ỉrp⸢y⸣.w; ỉrpy.w; ỉrpꜣ; ỉrpꜣ.w; ⸢ỉrpꜣ⸣.w "Tempel" |       |
| ỉrm "mit, und [Präp.]" |       |
| ỉrm pꜣ ḫpr ꜥn "und ferner" | 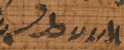 |
| ỉḥ.t "Kuh" |  |
| ỉšr "Syrer, Assyrer" |  |
| ỉṱ "Vater" |    |
| yꜥr "Fluß, Kanal" | 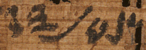 |
| yꜥr-ꜥꜣ "'großer Fluß', Nil" | 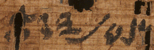 |
| Ybyꜣ "Elephantine [ON]" | 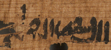 |
| [ꜥ].wỉ; ꜥwỉ.w "Haus, Platz" |   |
| ꜥꜣ "Art, Zustand" |  |
| ꜥꜣ; ꜥy.w; ⸢ꜥy.w⸣ "groß [Adjektiv]" |      |
| ⸢ꜥy.w-(n)-ms⸣ "alt sein, alt werden" |  |
| ꜥw; ꜥꜣ; ꜥy "groß sein [Adjektivverb]" |     |
| ꜥw-n-ỉr.t "Glück" |  |
| ꜥby.t "Spende, Opfer" | 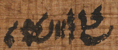 |
| ꜥn "erneut, wieder [Adverb]" |      |
| ꜥnḫ "leben" |     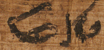  |
| ꜥnḫ "Leben" |  |
| ꜥrꜥy(.t); ꜥry(.t) "Uräusschlange" |        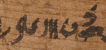 |
| ꜥrwy "vielleicht [Adv.]" | 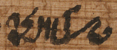 |
| ꜥrḳy "letzter Monatstag" |      |
| ꜥrḏ "Sicherheit, Festigkeit" |  |
| ꜥḥꜥ "stehen" |     |
| ꜥš "rufen" |    |
| ꜥš-šlly "flehen" |  |
| ꜥšꜣ "zahlreich sein [Adjektivverb]" |   |
| ꜥšꜣ "zahlreich [Adjektiv]" |  |
| ꜥḳ "Brot, Ration" |     |
| wꜣḥ-sḥn "befehlen" |  |
| wyꜥ "Bauer" | 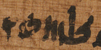 |
| Wynn.w; Wynn(.w) "Grieche" |   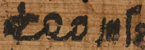 |
| wꜥ.t; wꜥ "eine" |      |
| wꜥb "Reinheit; Reinigung" |  |
| wꜥb; wꜥb.w "Priester" |        |
| wꜥb.w; wꜥb "rein sein, unbelastet sein" |        |
| wꜥb.t "Balsamierung, Tod" |  |
| wbꜣ "gegenüber [Präp.]" |  |
| wn "öffnen" |            |
| wn "sein, existieren" |    |
| wnm "rechts, rechte Seite" |    |
| wnm "essen" |      |
| wnty.w "Kurzhornrind, Opfertier " |  |
| wr<š>e "Altlicht; Mondmonat" |   |
| whꜥ "böse Tat, Sünde, Verfehlung" |  |
| wṱ "Befehl, Erlass, Dekret" |  |
| bỉk.w "Falke" |  |
| bw-ỉri̯; ⸢bw⸣-ỉri̯ "[Negation des Aorists]" |         |
| bw-ỉri̯-tw "noch nicht [neg. Perfekt]" |  |
| bn "[Negation]" |  |
| bn.ỉw "[Negation Futur III]" |     |
| bn.ỉw "[Negation Präsens I]" |    |
| bn-p "[Negation Vergangenheit]" |             |
| bnr "Außen, Außenseite" |  |
| blꜣ "lösen" |  |
| bš "entblößen, verlassen, reduzieren" |  |
| bgs "sich empören, rebellieren" |  |
| btw "Strafe" | 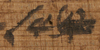    |
| bd(.t) "Emmer" |   |
| p.t; p(.t) "Himmel" |   |
| pꜣ; ⸢pꜣ⸣ "der [def. Art. sg. m.]" |                                                                                                                                          |
| pꜣ tꜣ (n) ẖr "Syrerland, Syrien [ON]" |   |
| pꜣ-bnr-n; pꜣ-bnr-(n) "außer, außerhalb [Präp.]" |   |
| pꜣ-hrw "heute, jetzt [Adverb]" |     |
| Pꜣ-šrỉ-Mw.t "Psammuthis [KN]" |  |
| pꜣỉ "[def. Art. sg. m. + Präfix der Relativform]" |   |
| pꜣỉ "dieser [Demonstrat. sg. m.]" |  |
| pꜣỉ; ⸢pꜣỉ⸣ "[Kopula sg. m.]" |                                     |
| pꜣy⸗w "ihr" |   |
| pꜣy⸗f; ⸢pꜣy⸗f⸣ "sein" |                               |
| pꜣy⸗k "dein" |  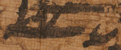   |
| ⸢pa⸣; pa "der von" |       |
| Py "Pe, Buto [ON]" | 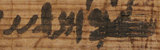  |
| py "Thron" |  |
| pr.w "Haus" |  |
| pr(.t) "Aussaat-Zeit, Peret, Winter" |       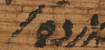     |
| pr-ꜥꜣ "König" |             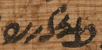       |
| pr-pr-ꜥꜣ "Königspalast" |  |
| Pr-nb(.t)-ṱp-ỉḥ "Aphroditopolis, Atfih [ON]" | 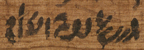 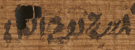 |
| pri̯ "herauskommen" |  |
| prḏꜣ "Kinn(?)" | 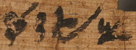 |
| pḥ "erreichen, ankommen" |       |
| pẖrꜣ "herumgehen, durchziehen" | 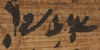 |
| pẖry.w(t); pẖry(.t) "Medikament, Zaubermittel" |    |
| Ptḥ "Ptah [GN]" |    |
| m-sꜣ; m-sꜣ⸗ "hinter [Präp.]" |                      |
| m-ḳdy; ⸢m⸣-ḳdy; m-ḳde "in der Art von [Präp.]" |    |
| m-tw⸗ "bei, jemanden gehören [Präp.]" |      |
| m-tw⸗ "durch [Präp.]" |  |
| m-ḏr; (n)-ḏr.ṱ⸗ "bei, durch [Präp.]" |   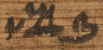    |
| mꜣỉ.w(t) "Insel" |  |
| mꜣꜥ.w; mꜣꜥ "Ort, Platz" |   |
| mꜣḫe.t; mꜣḫe(.t) "Waage" |   |
| mỉ(.t); mỉ.t "Straße" |  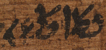 |
| my "[enklitische Partikel nach dem Imperativ]" |  |
| my; ⸢m⸣y; ⸢my⸣ "[Imperativ von ḏi̯.t]" |    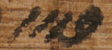    |
| myt "Weg, Rechtsanspruch" |   |
| mꜥḏy "Profit" | 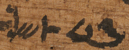  |
| mw "Wasser" |    |
| Mw(.t) "Mut [GN]" |     |
| ⸢mwt⸣; mwt "sterben" |   |
| mn; bn.ỉw "es gibt nicht [Negation der Existenz]" |       |
| [Mn]-nfr; Mn-nfr "Memphis [ON]" |    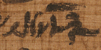 |
| mnḫ "tugendhaft, wohltätig sein [Adjektivverb]" | 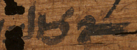   |
| mnḫ "Wohltat, gute Tat" |  |
| mnḳ "Vollendung" |    |
| mnḳ "vollenden" |   |
| mr.t "Liebe, Beliebtheit, Wunsch, Wille" |  |
| mri̯; mri̯.ṱ⸗ "lieben, wünschen" |    |
| mlẖ "Streit" |  |
| mḥ "füllen" |         |
| mḥ-10.t "zehntes" |  |
| mḥ-11 "elftes" |  |
| mḥ-12 "zwölftes" |  |
| mḥ-13 "dreizehntes" |  |
| [mḥ-14] "vierzehntes" | |
| mḥ-2 "zweiter" |      |
| mḥ-3 "dritter" |      |
| mḥ-4 "vierter" |    |
| mḥ-5 "fünfter" |    |
| mḥ-6 "sechster" |    |
| mḥ-7.t; mḥ-7 "siebtes" |    |
| mḥ-8.t "achtes" |  |
| mḥ-9.t "neuntes" | 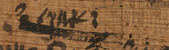 |
| mh̭y "gleichen, vergleichen" |  |
| mh̭y; [m]h̭y; mh̭⸢y⸣ "schlagen" |    |
| ms.t; ⸢ms⸣ "Geburt" | 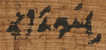  |
| msḥ.w "Krokodil" | 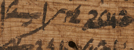 |
| mšꜥ "Armee, Volksgruppe, Menge" |   |
| mšꜥ "gehen, marschieren" |   |
| mtỉ "Flut, Wasser" | 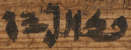 |
| mtw "[Bildungselement des Konjunktivs]" |    |
| mtw⸗s "[selbst. Pron. 3. Sg. f.]" |  |
| mtr "Zeuge sein, zugegen sein" |  |
| md.w(t); md(.t); ⸢md(.t)⸣ "Rede, Wort, Sache, Angelegenheit" |         |
| Mdy.w; Mdy⸢.w⸣; Mdy(.w) "Meder, Perser" | 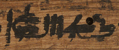 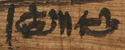          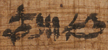 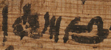  |
| n; ⸢n⸣ "des [Genitiv]" |                  |
| n; n.ỉm⸗; ⸢n.ỉm⸗⸣; {r} <n> "in (< m) [Präp.]" |                                                                |
| n; n⸗ "zu, für (< n; Dativ)" |                          |
| n.ỉm "dort [Adverb]" |   |
| n.n⸗w "für sie" |       |
| n⸗k "für dich" |  |
| (n)-wꜥ-sp "alle zusammen" |  |
| (n)-bnr "außen, draußen [Adverb]" |  |
| (n)-rn; (n)-rn⸗; ⸢(n)-rn⸣; (n-)rn "besagter, betreffender" |         |
| (n)-tꜣ-ḥꜣ.t "früher, vorne [Adverb]" |  |
| (n)-ṯꜣi̯-(n) "von ... an, seit [Präp.]" |  |
| n-ḏr(.t) "als, nachdem [Temporalis]" |        |
| nꜣ; ⸢nꜣ⸣ "die [def. Art. pl. c.]" |                                                                                             |
| nꜣ.w "[def. Art. pl. c. + Präfix der Relativform]" |      |
| nꜣ.w "[Kopula Plural]" |       |
| nꜣ.w; n⸗ỉ "für mich" |   |
| nꜣ-ꜥn; ꜥn "schön sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣ-nḏm; nḏm "angenehm sein, froh sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣy "diese [Demonstrat. pl. c.]" |    |
| nꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| nꜣy⸗w "ihre" |   |
| nꜣy⸗f "seine" |     |
| Nꜣy⸗f-ꜥw-rd.wỉ "Nepherites [KN]" |  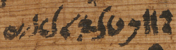 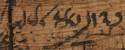 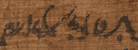  |
| nꜣy⸗n "unsere" |   |
| nꜣy⸗s "ihre" |  |
| nꜣy⸗k "deine" |  |
| nw "sehen" |     |
| nwḥ "Strick" |   |
| nb "Gold" |   |
| ⸢nb⸣ "jeder; irgendein" |  |
| nb; nb.w "Herr" |    |
| nb.t "Frevel, Sünde" |  |
| nb(.t); nb.t "Herrin" |   |
| nb-n-ḫꜥi̯ "Herr der Erscheinungen" |  |
| nfr "gut sein [Adjektivverb]" |   |
| nfr "gut [Adjektiv]" |  |
| nmꜣy(.t)(?) "'Wanderin' (?)" |   |
| nhe(.t) "Sykomore" |  |
| nḫ(?)(.t) "Klage, Totenklage" | 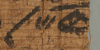 |
| nḫby(.t) "Königstitulatur" | 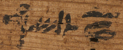 |
| Nḫṱ-nb⸗f "Nektanebos I. [KN]" |  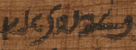 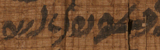 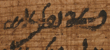     |
| nsw "König" |  |
| nkt "Sache" |    |
| nkt-ḥwrꜥ "Raubgut" |  |
| ntỉ; ⸢ntỉ⸣ "[Relativkonverter]" |                                                               |
| ntỉ.ỉw "[Relativkonverter]" |                 |
| ntỉ.ỉw⸗f "[Relativkonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |  |
| ntỉ.ỉw⸗k "[Relativkonverter + Suffixpron. 2 sg. m.]" |  |
| ntỉ-ỉri̯ "[Relativkonverter + r im Futur III vor nominalem Subjekt]" |  |
| ntỉ-wꜥb "Sanktuar" |     |
| nṯr "Gott" |      |
| nṯr.w "Götter" |      |
| r "[im Futur III vor nominalem Subjekt]" |       |
| r "[im Futur III vor Infinitiv]" |            |
| r "macht (bei Beträgen u.ä.)" |    |
| r; ỉw; ⸢ỉw⸣ "indem, wobei [Umstandskonverter]" |                 |
| r; [r]; r.ḥr⸗ "zu, hin [Präp.]" |                                      |
| r.r⸗w "zu ihnen" |     |
| ⸢r⸣.r⸗f "zu ihm" |  |
| r.r⸗k "zu dir" |   |
| r-wbꜣ "gegen, gegenüber, vor [Präp.]" |   |
| r-bw.nꜣỉ "hierher [Adverb]" |  |
| r-bnr "heraus [Adverb]" |  |
| r-hn "bis hin zu [Präp.]" |   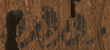 |
| r-ḥr "auf, vor [Präp.]" |  |
| r-ẖ(.t) "in der Art von, entsprechend [Präp.]" |    |
| (r)-ḏbꜣ; (r)-ḏbꜣ⸗; ⸢(r)-ḏbꜣ⸣ "wegen [Präp.]" | 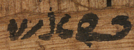    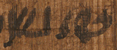  |
| Rꜥ "Re [GN]" |      |
| r:wn-nꜣ.w-⸢ỉw⸗⸣ "[Präfix der Relativform + Imperfektkonverter]" |  |
| rmy "weinen, beweinen" | 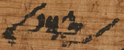  |
| rmy(.t) "Träne" |  |
| rmṯ; rmṯ.w "Mensch, Mann" |            |
| rmṯ.w-rḫ.w "Gelehrter" |  |
| rmṯ-(n)-ḳnḳn; rmṯ.w-(n)-ḳnḳn "Krieger" |   |
| rn "Name" |    |
| rnp(.t); rnp.w(t) "Jahr" |           |
| rḫ; ỉr.rḫ "wissen, können" |   |
| rše; ršy "sich freuen" | 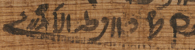  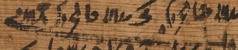  |
| ršy "Freude" |  |
| (r:)ḳd "bauen" |  |
| rd.wỉ "Fuß" |  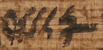  |
| lk "aufhören, beseitigen" |        |
| <mḥ-1>; mḥ-1 "erster" |   |
| <3.nw> "dritter" | |
| hꜣ; ⸢h⸣[ꜣ] "Zeit" |           |
| hb "senden, schicken" |  |
| ⸢hp⸣; hp "Recht, Gesetz, Gesetzanspruch" |             |
| hri̯.w "zufrieden sein, besänftigt sein" |  |
| hrw "Tag" |  |
| Hgr; Hḳr "Hakoris [KN]" |  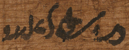 |
| htmꜣ "Thron" |  |
| ḥꜣ(.t) "vor [Präp.]" |   |
| ḥꜣ.t; ḥꜣ(.t) "Vorderteil, Anfang, Spitze" |     |
| ḥꜣ.tỉ; ḥꜣ.tỉ⸗ "Herz" |       |
| ḥꜣṱ; ḥꜣṱ.t "erster, früherer [Adjektiv]" |   |
| ḥꜥ⸗ "selbst" |   |
| ḥw.ṱ "Ackerbauer" |  |
| Ḥw.t-nn-nsw; Ḥw.t-(nn)-nsw "Herakleopolis [ON]" |    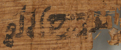   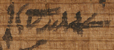   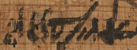 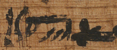 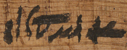 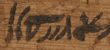  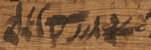  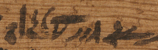 |
| ḥwe(.t); ḥwe.t; ⸢ḥwe⸣[.t] "Kapitel, Strophe" |         |
| ḥwy "Regen" |   |
| ḥwy "schlagen, werfen" |  |
| ḥwrꜥ "rauben, berauben" |   |
| ḥwrꜥ; ḥwrꜥ(.w) "Raub, Räuberei" |    |
| ḥwṱ "Mann, männlich" |  |
| ḥbs "bekleiden, bedecken" | 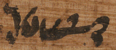 |
| ḥbs.w "Kleidung" |  |
| Ḥp "Apisstier [GN]" |        |
| ḥm.t "Frau, Ehefrau" |  |
| ḥm-nṯr; ⸢ḥm-nṯr(?)⸣ "Gottesdiener, Prophet" |     |
| ḥmꜣ.t "Gebärmutter" |   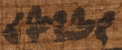 |
| ḥn "befehlen" |   |
| ḥnꜥ "und, zusammen mit, oder [Präp.]" |  |
| ḥr "auf [Präp.]" |           |
| ḥr-ꜣt⸗ "auf [Präp.]" | 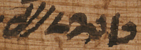 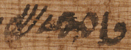 |
| Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) "Horus, Sohn der Isis [GN]" |    |
| Ḥr-šf "Herischef [GN]" |      |
| ḥrỉ "oben [Adverb]" |    |
| ḥrỉ "Oberster, Herr, Vorgesetzter" |                                           |
| ḥrḥ "wachen, hüten" |  |
| ḥlly; ḥll "Trübung, Finsternis (?)" | 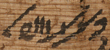  |
| ḥsb(.t); ⸢ḥsb(.t)⸣ "Regierungsjahr" |      |
| ḥḳr; ḥḳꜣ "hungern" |     |
| ḥtp-nṯr "Gottesopfer" |  |
| ḥḏ "Silber, Geld" |  |
| ḥḏ.t "Weiße Krone" |  |
| ḫꜣ "Meßstab" |   |
| ḫꜣꜥ "werfen, legen, lassen, verlassen" |          |
| ḫꜣsy(.t); ḫꜣs.w(t); ḫꜣs(.wt) "Fremdland, Wüste, Nekropole" |        |
| h̭yh̭e "Staub" |  |
| ḫꜥ "Fest" |  |
| ḫꜥi̯ "erscheinen" |     |
| ḫby "vermindern, abschneiden, rasieren" |  |
| ḫpr "geschehen" |                                                  |
| ḫpr "es ist so (dass), denn, weil [Konjunktion]" |        |
| ḫpš; ḫbš "Sichelschwert" |    |
| ḫm.w "klein, jung [Adjektiv]" |  |
| ḫm-ẖr.w; ḫm-ẖr(.w) "Knabe, junger Mensch, Bursche, Kind" | 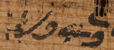 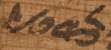   |
| Ḫmnw "Hermopolis [ON]" |  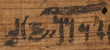 |
| ḫnṱ "stromauf fahren" |   |
| ḫr "[Präfix des Aorists]" |     |
| ḫrw "Stimme" |  |
| ḫštrpn "Satrap" | 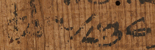 |
| ḫt(.w) "Holz, Bäume" |   |
| ẖ(.t) "Kopie, Abschrift, Wortlaut" |  |
| ẖꜣ(.t) "Gemetzel" |     |
| ẖꜥ.t "Ende" |  |
| ẖn; ẖn⸗ "in [Präp.]" | 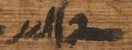       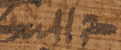   |
| H̱nm "Chnum [GN]" | 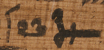  |
| ẖr "Syrer" |   |
| ẖr; ẖr.r.ḥr⸗ "unter, wegen [Präp.]" |   |
| ẖr.t "Speise, Nahrung" |  |
| ẖr-nṯr "Steinmetz" |   |
| ẖrꜣ(.t) "Gewand, Riemen" | 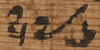 |
| ẖry.w; ẖry "Straße, Weg" |  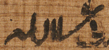 |
| ẖry.t "Witwe" |  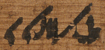 |
| s; st; ⸢s⸣ "[enklit. Pron. 3. sg. m.]" |                |
| s.t "Platz, Ort" |  |
| sꜣ "Phyle" |    |
| sỉ-n-ꜥḳ "Bäcker" |   |
| sꜥnḫ "ernähren, leben lassen" |  |
| sw "Monatstag" |            |
| sw-10 "Dekade" |    |
| swr "trinken" |  |
| sbꜣ.w "Tür" |   |
| sbḳ(.w) "klein, gering [Adjektiv]" |  |
| sbt "herrichten, ausrüsten, vorbereiten, versorgen" |  |
| sp "Rest" |     |
| sp "Fall, Angelegenheit, Mal" |   |
| sp-2 "zweimal [Wiederholungszeichen]" |   |
| sf "gestern [Adverb]" |   |
| s[fy] "Messer, Schwert" |  |
| smn "aufsetzen, feststellen, dauern (lassen)" |  |
| smḥ (?) "links" |    |
| smt; [s]mt "Art, Weise, Gestalt" |      |
| sn.w "Bruder" |  |
| ⸢s⸣nty "sich fürchten" |  |
| sḥm.t "Frau" |  |
| sḥn "Krone, Diadem" |   |
| sḥn "Angelegenheit, Amt, Befehl, Auftrag" |  |
| sḥn.ṱ; sḥn "befehlen, beauftragen" |   |
| sḫ(.t) "Feld" |  |
| sẖꜣ "Schrift" |  |
| sẖꜣ; ⸢sẖꜣ⸣ "schreiben" |          |
| sẖꜣ.w "Schreiber" |  |
| sẖꜣ-ỉšr "syrische Schrift, Aramäisch" |  |
| ssw; ss.w; ⸢ss.w⸣ "Termin, Zeit" |             |
| sḳꜣ "zusammenfügen, sammeln" |  |
| sgrꜣ.w "Herde (o.ä.)" |  |
| st "[enklit. Pron. 3. pl. c.]" |  |
| stbḥ(.t) "Gerät, Waffe" |  |
| stbḥ(.t)-n-ḳnḳn "Kampfgerät, Waffen" |  |
| sṯꜣ.ṱ "(sich) zurückziehen, wenden" |  |
| sdb "essen" |  |
| sḏm "hören" |  |
| šy(.w) "See" |  |
| šw "Wert, Nutzen" |  |
| šbi̯.t "Veränderung, Tausch, Entgelt" |   |
| ⸢šm⸣; šm "gehen" |               |
| šm.w "Gang, Reise" |  |
| šmsi̯(?); šmsi̯ "folgen, dienen, geleiten" |     |
| šn "Krankheit" |  |
| šn.w "Inspektion, Untersuchung" |  |
| šni̯ "fragen, suchen, untersuchen" |       |
| šni̯ "krank sein" |  |
| šnꜥ "abweisen, abhalten" |  |
| šnt(.t); ⸢šnt(.t)⸣ "Schurz, Tuch" |   |
| šrỉ "Sohn" |        |
| šll "beten, flehen" | 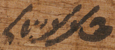 |
| šlly "Wehruf, Wehklage" | 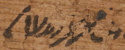 |
| šsp; ⸢šsp⸣ "empfangen" |      |
| ḳb "verdoppeln" |  |
| ḳbꜣ(.t) "Gefäß, Krug" |  |
| ḳn "Stärke, Sieg" |  |
| ḳnḥ.t "Schrein, Naos" | 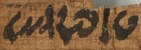 |
| ḳnḳn "schlagen, kämpfen" |    |
| ḳlꜣ.t; ḳlꜣ.w(t) "Riegel, Zapfen" |   |
| ḳdy "umherziehen" |  |
| k.ṱ.t "andere [sg. f.]" |   |
| kꜣm "Garten" | 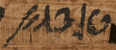 |
| kꜣmy "Gärtner, Winzer" |  |
| kỉỉ.w "anderer [sg. m.]" |  |
| Kbḏe "Kambyses [KN]" | 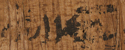 |
| Km; ⸢Km⸣ "Ägypten" |                    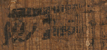  |
| gbꜣ.t "Sproß, Blatt, Nachkommenschaft" | 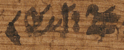 |
| gby.w "Schwacher" |  |
| gmi̯ "finden" |       |
| grp "öffnen, enthüllen, offenbaren" |  |
| gsgs "tanzen" |  |
| gst "Palette" |   |
| gḏwḏꜣ "Mensch aus Gaza, Diener" | 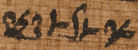 |
| tꜣ "Land, Welt, Erde" |      |
| tꜣ; ⸢tꜣ⸣ "die [def. Artikel sg. f.]" |                                                     |
| Tꜣ-Mḥy "Unterägypten" |  |
| Tꜣ-Šmꜥ "Oberägypten [ON]" |   |
| tꜣỉ "[Kopula sg. f.]" |        |
| tꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| tꜣy⸗f "seine" |     |
| tꜣy⸗s "ihre" |    |
| tꜣy⸗k "deine" |     |
| ta "die von" |  |
| Ta-bꜣ.ỉyi̯ "Tabis(?)" | 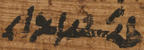 |
| tw⸗ỉ "[proklit. Pron. 1. sg. c.]" |   |
| tw⸗n "[proklit. Pron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸢tw⸣⸗tn "[proklit. Pron. 2. pl. c.]" |  |
| twꜣ "Berg" |  |
| twtw "sammeln, sich versammeln" |  |
| tp.t; tp "erster [Adjektiv]" |   |
| tpy.t "Anfang" | 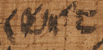 |
| tfy "wegnehmen, entfernen" |  |
| tm "[Negationsverb]" |    |
| tm-hp "Unrecht" |  |
| Tryꜣwš "Dareios [KN]" |  |
| ṱrry "Ofen" |  |
| tḥ⸢ꜣ⸣ "Bitternis, Leiden, Krankheit" |  |
| tḥꜣ "betrübt sein, bitter sein, krank sein" |  |
| ṱḥs "salben" | 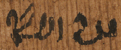 |
| tḫ(?)s(.t) "?" |  |
| tš; ⸢tš⸣.w "Bezirk, Provinz" |   |
| ṱkn "nahe kommen, eilen" |   |
| ṯꜣi̯ "nehmen, empfangen" |     |
| dp-n-ỉꜣw.w(t) "Vieh" |  |
| Dpꜣy; Dpꜣ; Dpyꜣ "Dep (Stadtteil von Buto) [ON]" |    |
| dmḏ "Summe" |         |
| dnỉ(.t) "Anteil" |  |
| dšry(.t) "Rote Krone" |  |
| ḏꜣḏꜣ "Kopf" |     |
| ḏi̯; ḏi̯.t; ḏi̯⸗; ⸢ḏi̯.t⸣ "geben" |                                             |
| ḏm "Geschlecht, Nachkomme, Generation; Jungmannschaft; Kalb" |  |
| ḏmꜥ; ḏm⸢ꜥ⸣ "Papyrusrolle, Buch" |    |
| ḏmꜥy "trauern, klagen" | 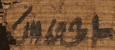 |
| ḏn⸢f⸣; ḏnf "Gewicht, Maß, Gleichgewicht" |   |
| ḏr(.t); ḏr(.t)⸗ "Hand" |    |
| ḏr⸗ "ganz, alle" |    |
| ḏrꜣ; ḏ⸢r⸣ꜣ "stark, siegreich sein [Adjektivverb]" |     |
| ḏlḏ "Pflanzung, Hecke (?)" |   |
| Ḏḥw.tỉ "Thot [GN]" |   |
| Ḏd "Djed-Pfeiler" |   |
| ḏd; ⸢ḏd⸣ "[Konjunktion]" |                                                                                                   |
| ḏd.ṱ; ḏd; (r:)ḏd "sagen, sprechen" |                              |
| Ḏd-ḥr "Tachos, Taos [KN]" | 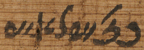 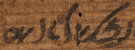 |
| 1; (sw)-1 "Tag 1" |     |
| 10 "10" |  |
| 13 "13" |  |
| 16 "16" |   |
| 18 "18" |   |
| 19 "19" | 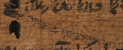  |
| 2 "(Tag) 2" |  |
| 2.nw; {2.nw} "zweiter" |   |
| 27 "27" |  |
| 3 "(Tag) 3" |  |
| 3; 3.t "3" |        |
| 4 "(Tag) 4" |  |
| 44; 44.t "44" |   |
| 5 "(Tag) 5" |  |
| 5.t; 5 "5" |    |
| 6 "(Tag) 6" |  |
| 6 "6" |   |
| 7 "7" |  |
| 7; (sw)-7 "(Tag) 7" |   |
| 8 "8" |  |
| 𓂞'𓏲 | 𓂞𓏲 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |  |
| :**𓅓1𓄿1** | :𓅓𓄿 |  |
| :𓎆 | :𓎆 |    |
| :𓏾 | :𓏾 |  |
| :𓐀 | :𓐀 |  |
| :𓐂 | :𓐂 |  |
| 𓀀3 | 𓀀 |   |
| 𓀀:𓈖 |   | |
| 𓀁 | 𓀁 |                                                                                                       |
| 𓀁1 | 𓀁 |  |
| 𓀁° | 𓀁 |                            |
| 𓀎 | 𓀎 |   |
| 𓀎𓏰:𓀀𓀁 | 𓀎 |   |
| 𓀐 | 𓀐 |                                                  |
| 𓀐1 | 𓀐 |   |
| 𓀔 | 𓀔 |                             |
| 𓀗 | 𓀗 |      |
| 𓀢2 | 𓀢 |  |
| 𓀨 | 𓀨 |   |
| 𓀹1 | 𓀹 |  |
| 𓀼 | 𓀼 |   |
| 𓀾1 | 𓀾 |  |
| 𓁐9 | 𓁐 |  |
| 𓁗1 | 𓁗 |   |
| 𓁗1:° | 𓁗 |  |
| 𓁶𓏤1 | 𓁶𓏤 |      |
| 𓁶𓏤1𓊪1 | 𓁶𓏤𓊪 |  |
| 𓁶𓏤1𓊪1:° | 𓁶𓏤𓊪 |    |
| 𓁷𓏤 | 𓁷𓏤 |                        |
| 𓁷𓏤1𓀀3 | 𓁷𓏤𓀀 |   |
| 𓁹:𓂋*𓏭 |                                                                                      | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑 |                 | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑1 |    | |
| 𓁹:𓏏*𓏤𓁻1 |   | |
| 𓁻2 | 𓁻 |  |
| 𓁻:° | 𓁻 |           |
| 𓂊2:° | 𓂊 |   |
| 𓂋 | 𓂋 |                |
| 𓂋1 | 𓂋 |                                                                                             |
| 𓂋1𓂋:𓆑 | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓎡° | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓏥𓏲 | 𓂋 |     |
| 𓂋3𓌥 | 𓂋𓌥 |       |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1'𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲 |   |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲𓏲 |     |
| 𓂋:𓂋 |    | |
| 𓂋:𓂧 |      | |
| 𓂋:𓂧:° |  | |
| 𓂋:𓂧:°𓌗1 |  | |
| 𓂋:𓂧@ |   | |
| 𓂋:𓂧@𓂾𓂾 |   | |
| 𓂋:𓂧𓂾𓂾 |  | |
| 𓂋:𓂧𓌗1 |    | |
| 𓂋:𓂧𓌗2 |  | |
| 𓂋:𓆑 |  | |
| 𓂋:𓊪 |       | |
| 𓂋:𓍿𓀀𓏪 |            | |
| 𓂋:𓎡 |  | |
| 𓂋:𓎡° |  | |
| 𓂋:𓏏*𓏰 |              | |
| 𓂋:𓏥𓏲 |     | |
| 𓂋:𓐍 |   | |
| 𓂋:𓐍@1 |  | |
| 𓂓𓏤1 | 𓂓𓏤 |  |
| 𓂓𓏤2 | 𓂓𓏤 |   |
| 𓂚3 | 𓂚 |  |
| 𓂚3𓍘𓇋4 | 𓂚𓍘𓇋 |  |
| 𓂜1 | 𓂜 |   |
| 𓂜1:𓅪 |   | |
| 𓂝 | 𓂝 |             |
| 𓂝:𓂝 |   | |
| 𓂝:𓂝:° |  | |
| 𓂝:𓂝:°𓏤 |  | |
| 𓂝:𓂝𓏤 |    | |
| 𓂝:𓂻 |         | |
| 𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥 |       | |
| 𓂝:𓈖 |  | |
| 𓂝:𓈖:° |  | |
| 𓂝:𓈖𓏌𓏲1 |  | |
| 𓂝:𓈙𓀞2 |    | |
| 𓂞'𓏲 | 𓂞𓏲 |      |
| 𓂞:𓏏2 |          | |
| 𓂞:𓏏3 |                       | |
| 𓂞:𓏏3 𓏞𓍼:𓏤@ |  | |
| 𓂞:𓏏3𓋴𓏏3𓏏 |         | |
| 𓂞:𓏏6 |                 | |
| 𓂞:𓏏6𓏲 |                 | |
| 𓂧 | 𓂧 |   |
| 𓂧':𓏭 |               | |
| 𓂧:𓏏*𓏤 |            | |
| 𓂭:𓎆 |  | |
| 𓂭:𓎈 |  | |
| 𓂭:𓏿 |  | |
| 𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 |   |
| 𓂷:𓂡1 |     | |
| 𓂷:𓂡1:° |  | |
| 𓂸:𓏏 |   | |
| 𓂸:𓏏𓂭𓂭 |   | |
| 𓂺1 | 𓂺 |  |
| 𓂻 | 𓂻 |                   |
| 𓂻1:° | 𓂻 |  |
| 𓂻:° | 𓂻 |                                  |
| 𓂼 | 𓂼 |   |
| 𓂼1 | 𓂼 |  |
| 𓂼2 | 𓂼 |  |
| 𓂼2𓂼1 | 𓂼𓂼 |  |
| 𓂼𓏲1𓂼 | 𓂼𓏲𓂼 |  |
| 𓂽 | 𓂽 |   |
| 𓂽1 | 𓂽 |     |
| 𓂽:° | 𓂽 |  |
| 𓂾𓂾 | 𓂾𓂾 |    |
| 𓃀 | 𓃀 |   |
| 𓃀3𓏲1 | 𓃀𓏲 |          |
| 𓃀4𓏲4 | 𓃀𓏲 |     |
| 𓃀:𓈖1 |                   | |
| 𓃀:𓈖1:° |         | |
| 𓃀:𓈖1:°𓊪:𓏭2 |  | |
| 𓃀:𓈖1𓊪:𓏭2 |            | |
| 𓃀𓏲1 | 𓃀𓏲 |                  |
| **𓃀𓏲1𓅃𓅆'**:𓎡1 |  | |
| 𓃂 | 𓃂 |                  |
| 𓃂𓈘:𓈇 | 𓃂 |    |
| 𓃂𓈘:𓈇:° | 𓃂 |               |
| 𓃛 | 𓃛 |     |
| 𓃛𓃛 | 𓃛𓃛 |   |
| 𓃭 | 𓃭 |                                              |
| 𓃭𓏤 | 𓃭𓏤 |                       |
| 𓃹:𓈖 |           | |
| 𓃹:𓈖2 |            | |
| 𓄂:𓏏*𓏤 |                 | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1𓄣𓏤 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤 |   | |
| 𓄋:𓊪1 |   | |
| 𓄋:𓊪@ |       | |
| 𓄋:𓊪@𓏲𓏭:𓏛 |     | |
| 𓄑:𓏛 |  | |
| 𓄑:𓏛1 |                          | |
| 𓄑:𓏛@ |   | |
| 𓄕 | 𓄕 |  |
| 𓄕𓅓𓏭:𓏛 | 𓄕𓅓 |  |
| 𓄖:𓂻 |       | |
| 𓄛1 | 𓄛 |        |
| 𓄛2 | 𓄛 |  |
| 𓄞:𓂧 |  | |
| 𓄟1 | 𓄟 |   |
| 𓄡:𓏏*𓏤 |    | |
| 𓄡:𓏏*𓏤@ |     | |
| 𓄣1𓏤1 | 𓄣𓏤 |  |
| 𓄣𓏤 | 𓄣𓏤 |        |
| 𓄤 | 𓄤 |         |
| 𓄤𓏭:𓏛 | 𓄤 |        |
| 𓄧 | 𓄧 |   |
| 𓄹:𓏭 |                                          | |
| 𓄹:𓏭1 |  | |
| 𓄿 | 𓄿 |       |
| 𓄿1 | 𓄿 |                                                                      |
| 𓄿:° | 𓄿 |         |
| 𓄿:°𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓄿𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓅃𓅆 | 𓅃𓅆 |     |
| 𓅆 | 𓅆 |                                                                                                           |
| 𓅆@ | 𓅆 |            |
| 𓅆@° | 𓅆 |   |
| 𓅆° | 𓅆 |      |
| 𓅐 | 𓅐 |      |
| 𓅐𓏏:𓆇 | 𓅐 |    |
| 𓅐𓏲2𓏏:𓆇 | 𓅐𓏲 |  |
| 𓅓 | 𓅓 |                                                         |
| 𓅓'𓎔 | 𓅓𓎔 |  |
| 𓅓1 | 𓅓 |                                                                              |
| 𓅓1𓄿1 | 𓅓𓄿 |  |
| 𓅓1𓅐𓏏:𓆇 | 𓅓𓅐 |  |
| 𓅓1𓈖:𓏥 | 𓅓 |  |
| 𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓅓𓐠𓏤 |                         |
| 𓅓:𓏏 |   | |
| 𓅓:𓏏𓀐 |   | |
| 𓅓𓁹 | 𓅓𓁹 |    |
| 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 | 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 |  |
| 𓅓𓎔 | 𓅓𓎔 |         |
| 𓅓𓏭 | 𓅓𓏭 |    |
| 𓅓𓏭:𓏛 | 𓅓 |      |
| 𓅓𓏭:𓏛@ | 𓅓 |       |
| 𓅝:𓏏*𓏭 |   | |
| 𓅝:𓏏*𓏭𓅆 |   | |
| 𓅠 | 𓅠 |       |
| 𓅠𓏭:𓏛 | 𓅠 |       |
| 𓅡◳𓏤 |                           | |
| 𓅨:𓂋*𓏰 |     | |
| 𓅪 | 𓅪 |        |
| 𓅪:° | 𓅪 |      |
| 𓅬 | 𓅬 |   |
| 𓅬3 | 𓅬 |   |
| 𓅯𓄿 | 𓅯𓄿 |                                                                                                                                                                      |
| 𓅯𓄿3 | 𓅯𓄿 |  |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓅯𓄿𓇋𓇋 |     |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 | 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 |                                 |
| 𓅯𓄿𓏭1 | 𓅯𓄿𓏭 |                                        |
| 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 | 𓅯𓄿𓏲 |    |
| 𓅱 | 𓅱 |          |
| 𓅱𓃀4𓏲4 | 𓅱𓃀𓏲 |     |
| 𓅱𓄋:𓊪@ | 𓅱 |  |
| 𓆄 | 𓆄 |   |
| 𓆇:𓏤 |    | |
| 𓆈:𓏥 |    | |
| 𓆊 | 𓆊 |        |
| 𓆎 | 𓆎 |  |
| 𓆎@2 | 𓆎 |                     |
| 𓆎@2𓅓1 | 𓆎𓅓 |               |
| 𓆎@2𓅓𓏭:𓏛 | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆎@2𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |      |
| 𓆎𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆑 | 𓆑 |                                                                                                                               |
| 𓆑1 | 𓆑 |          |
| 𓆑1𓅆 | 𓆑𓅆 |        |
| 𓆑4 | 𓆑 |     |
| 𓆑:𓏭 |    | |
| 𓆓:𓂧 |                                                                                                                                        | |
| 𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3 |   | |
| 𓆙 | 𓆙 |             |
| 𓆛:𓈖 |    | |
| 𓆣:𓂋𓏲 |                                                           | |
| 𓆤1 | 𓆤 |   |
| 𓆤1:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓆮 | 𓆮 |      |
| 𓆰:𓈖𓏪:° |       | |
| 𓆰𓏪 | 𓆰𓏪 |      |
| 𓆰𓏪@1 | 𓆰𓏪 |         |
| 𓆱:𓏏*𓏤 |                               | |
| 𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥:° |      | |
| 𓆱:𓏥:° |      | |
| 𓆳 | 𓆳 |           |
| 𓆳𓏏:𓊗3 | 𓆳 |      |
| 𓆳𓏤𓏰:𓇳5 | 𓆳𓏤 |           |
| 𓆷 | 𓆷 |     |
| 𓆷1 | 𓆷 |      |
| 𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳1 | 𓆷𓏰𓏰 |     |
| 𓆸 | 𓆸 |      |
| 𓆼 | 𓆼 |               |
| 𓆼1 | 𓆼 |        |
| 𓆼𓄿3 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿3𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿5 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿5𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿𓂝:𓂻1 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓇁 | 𓇁 |   |
| 𓇇 | 𓇇 |  |
| 𓇋 | 𓇋 |  |
| 𓇋1 | 𓇋 |            |
| 𓇋1𓇋𓀀 | 𓇋𓇋𓀀 |   |
| 𓇋1𓏏:𓆑 | 𓇋 |    |
| 𓇋2 | 𓇋 |              |
| 𓇋2𓂋:𓊪 | 𓇋 |           |
| 𓇋2𓆛:𓈖 | 𓇋 |    |
| 𓇋2𓊪1 | 𓇋𓊪 |   |
| 𓇋5 | 𓇋 |         |
| 𓇋5:𓎡 |         | |
| 𓇋𓀁 | 𓇋𓀁 |             |
| 𓇋𓀁1 | 𓇋𓀁 |                                      |
| 𓇋𓀁1𓋴𓏏 | 𓇋𓀁𓋴𓏏 |   |
| 𓇋𓀁𓂋:𓎡 | 𓇋𓀁 |  |
| 𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤 | 𓇋𓀁 |            |
| 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛 | 𓇋𓀁𓏤 |       |
| 𓇋𓂋:𓏭 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓂋:𓏭𓀹1 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓇋 | 𓇋𓇋 |             |
| 𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓇋𓇋 |          |
| 𓇋𓇋𓆑 | 𓇋𓇋𓆑 |    |
| 𓇋𓇋𓏲 | 𓇋𓇋𓏲 |                                                                                                                                        |
| 𓇋𓈖 | 𓇋𓈖 |       |
| 𓇋𓋴𓏏 | 𓇋𓋴𓏏 |                        |
| 𓇋𓎛𓃒 | 𓇋𓎛𓃒 |      |
| 𓇋𓏠:𓈖 | 𓇋 |     |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆 | 𓇋 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆° | 𓇋 |  |
| 𓇋𓏲 | 𓇋𓏲 |                                                                                                                                            |
| 𓇋𓏲 𓏪3 | 𓇋𓏲 𓏪 |  |
| 𓇋𓏲𓆑 | 𓇋𓏲𓆑 |                        |
| 𓇋𓏲𓏪 | 𓇋𓏲𓏪 |   |
| 𓇍1𓇋1 | 𓇍𓇋 |             |
| 𓇍1𓇋1𓂻 | 𓇍𓇋𓂻 |             |
| 𓇏:° | 𓇏 |  |
| 𓇓1 | 𓇓 |                   |
| 𓇓1𓅆 | 𓇓𓅆 |          |
| 𓇔3 | 𓇔 |  |
| 𓇔3𓏤𓏰:𓊖1 | 𓇔𓏤 |  |
| 𓇘 | 𓇘 |   |
| 𓇘:𓏏*𓏰𓅓 |   | |
| 𓇛1 | 𓇛 |   |
| 𓇣𓂧:𓏏*𓏰𓌽:𓏥1 | 𓇣 |   |
| 𓇥:𓂋1 |       | |
| 𓇥:𓂋1𓏭:𓏛 |   | |
| 𓇥:𓂋1𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2 |   | |
| 𓇥:𓂋2𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇯 | 𓇯 |                                                 |
| 𓇳 | 𓇳 |                            |
| 𓇳𓅆 | 𓇳𓅆 |      |
| 𓇳𓍼:𓏤 | 𓇳 |     |
| 𓇳𓍼:𓏤° | 𓇳 |  |
| 𓇳𓏤 | 𓇳𓏤 |   |
| 𓇹 | 𓇹 |   |
| 𓇹:𓇼 |   | |
| 𓇹:𓇼:𓇳 |   | |
| 𓇺:𓏺 |  | |
| 𓇺:𓏺1 |  | |
| 𓇺:𓏻1 |     | |
| 𓇺:𓏼@ |        | |
| 𓇺:𓏽@ |   | |
| 𓇾:𓏤@ |     | |
| 𓇾:𓏤𓈇@ |   | |
| 𓈉2 | 𓈉 |        |
| 𓈉2:𓏏*𓏤 |        | |
| 𓈌 | 𓈌 |   |
| 𓈌:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓈍:𓂝*𓏛 |      | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆 |    | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆° |  | |
| 𓈎 | 𓈎 |                |
| 𓈎:° | 𓈎 |  |
| 𓈎:𓈖 |     | |
| 𓈎:𓈖@ |    | |
| 𓈎:𓈖@𓏌𓏲1 |  | |
| 𓈎:𓈖𓏌𓏲1 |   | |
| 𓈐':𓏏*𓏤 |      | |
| 𓈐:𓂻 |     | |
| 𓈐:𓂻@ |   | |
| 𓈒 | 𓈒 |  |
| 𓈒:𓏥 |  | |
| 𓈒:𓏥1 |    | |
| 𓈒:𓏥2 |   | |
| 𓈔 | 𓈔 |   |
| 𓈖 | 𓈖 |                                                                    |
| 𓈖1 | 𓈖 |                    |
| 𓈖1:**𓄿1'𓇋𓇋𓏲** |   | |
| 𓈖1:**𓇛1𓅓1** |   | |
| 𓈖2 | 𓈖 |                                                |
| 𓈖2:𓄿1𓇋𓇋 |   | |
| 𓈖2:𓌳° |  | |
| 𓈖:𓀀° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖 |           | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁 |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁 |          | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁° |  | |
| 𓈖:𓄿 |                                                                                                                                | |
| 𓈖:𓄿° |                       | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |  | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑 |  | |
| 𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4 |       | |
| 𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥 |     | |
| 𓈖:𓈖9 |   | |
| 𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 |       | |
| 𓈖:𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖:**𓋴𓆰:𓈖𓏪:°** |       | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲 |        | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1 |     | |
| 𓈖:𓎡2 |  | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 |        | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 |    | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏲𓏭:𓏛 |     | |
| 𓈖:𓏌*𓏲 |                  | |
| 𓈖:𓏏 |  | |
| 𓈖:𓏏*𓏭1 |                                                                                          | |
| 𓈖:𓏥 |      | |
| 𓈖:𓏲*𓏥 |               | |
| 𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 | 𓈖𓇋𓅓 |                         |
| 𓈗 | 𓈗 |         |
| 𓈗𓈘:𓈇 | 𓈗 |         |
| 𓈘:𓈇 |             | |
| 𓈘:𓈇:° |               | |
| 𓈙 | 𓈙 |                   |
| 𓈝 | 𓈝 |                |
| 𓈝𓂻:° | 𓈝𓂻 |                |
| 𓉐2 | 𓉐 |         |
| 𓉐:𓉻 |                         | |
| 𓉐:𓉻𓅆 |                         | |
| 𓉐𓏤 | 𓉐𓏤 |                                            |
| 𓉐𓏤1 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@1 | 𓉐𓏤 |                                     |
| 𓉐𓏤@1𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@2 | 𓉐𓏤 |    |
| 𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |            |
| 𓉔 | 𓉔 |                                         |
| 𓉔1 | 𓉔 |    |
| 𓉗1 | 𓉗 |                          |
| 𓉗1:𓉐2 |   | |
| 𓉗1:𓉐𓏤 |  | |
| 𓉗1𓉐𓏤@1 | 𓉗𓉐𓏤 |                 |
| 𓉞 | 𓉞 |   |
| 𓉺1 | 𓉺 |  |
| 𓉺1:𓏏*𓏰𓏌 |  | |
| 𓉻 | 𓉻 |    |
| 𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 |    | |
| 𓉻:𓂝*𓏛 |                                                     | |
| 𓉿:𓂡1 |            | |
| 𓊃 | 𓊃 |       |
| 𓊃:𓀀:𓈖 |   | |
| 𓊃:𓈞𓁐2 |  | |
| 𓊌1 | 𓊌 |         |
| 𓊏 | 𓊏 |      |
| 𓊏𓏭:𓏛 | 𓊏 |      |
| 𓊑1 | 𓊑 |     |
| 𓊖 | 𓊖 |  |
| 𓊗:𓏻1 |   | |
| 𓊡 | 𓊡 |    |
| 𓊡𓏭:𓏛 | 𓊡 |  |
| 𓊡𓏲𓏭:𓏛 | 𓊡𓏲 |   |
| 𓊢𓂝:𓂻 | 𓊢 |     |
| 𓊤 | 𓊤 |  |
| 𓊤𓏲 | 𓊤𓏲 |  |
| 𓊨 | 𓊨 |    |
| 𓊨:° | 𓊨 |   |
| 𓊨:°𓏤𓉐𓏤 | 𓊨𓏤𓉐𓏤 |  |
| 𓊨𓏏:𓆇1 | 𓊨 |    |
| 𓊪 | 𓊪 |          |
| 𓊪1 | 𓊪 |                       |
| 𓊪1:° | 𓊪 |     |
| 𓊪1:𓉐𓏤1 |   | |
| 𓊪:° | 𓊪 |    |
| 𓊪:𓏏𓎛 |    | |
| 𓊪:𓏏𓎛𓅆 |    | |
| 𓊪:𓏭 |       | |
| 𓊪:𓏭2 |             | |
| 𓊮 | 𓊮 |     |
| 𓊵:𓏏@1 |  | |
| 𓊹 | 𓊹 |            |
| 𓊹𓅆 | 𓊹𓅆 |    |
| 𓊹𓅆° | 𓊹𓅆 |   |
| 𓊹𓊹𓊹 | 𓊹𓊹𓊹 |       |
| 𓊹𓊹𓊹1 | 𓊹𓊹𓊹 |      |
| 𓊹𓍛𓏤:𓀀 | 𓊹𓍛 |     |
| 𓊽 | 𓊽 |   |
| 𓊽1 | 𓊽 |   |
| 𓊽1𓊽1 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓊽𓊽 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓋀 | 𓋀 |     |
| 𓋀𓏤 | 𓋀𓏤 |    |
| 𓋀𓏤𓏰:𓊖3 | 𓋀𓏤 |  |
| 𓋁𓃀1 | 𓋁𓃀 |  |
| 𓋁𓃀1𓏤𓊖 | 𓋁𓃀𓏤𓊖 |  |
| 𓋞:𓈒*𓏥1 |   | |
| 𓋩1 | 𓋩 |   |
| 𓋩2 | 𓋩 |  |
| 𓋴 | 𓋴 |                                                    |
| 𓋴@𓏤 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴@𓏤𓄹:𓏭 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴𓇋1𓅨:𓂋*𓏰 | 𓋴𓇋 |  |
| 𓋴𓏏 | 𓋴𓏏 |                                                                 |
| 𓋴𓏏1𓏏 | 𓋴𓏏𓏏 |   |
| 𓋹𓈖:𓐍 | 𓋹 |         |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |          |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏2 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |                                |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏4 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |         |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰 | 𓌃 |          |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁 | 𓌃 |      |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁° | 𓌃 |     |
| 𓌉 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥 | 𓌉 |   |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥1 | 𓌉 |     |
| 𓌗1 | 𓌗 |     |
| 𓌗2 | 𓌗 |  |
| 𓌙:𓈉 |                   | |
| 𓌙:𓈉1 |           | |
| 𓌞:𓊃 |   | |
| 𓌞:𓊃1 |   | |
| 𓌞:𓊃1𓂻:° |   | |
| 𓌞:𓊃𓇋𓏲𓂻 |   | |
| 𓌡:𓂝*𓏤3 |   | |
| 𓌢° | 𓌢 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌨:𓂋𓏭:𓏛 |     | |
| 𓌪:𓂡 |      | |
| 𓌳° | 𓌳 |  |
| 𓌶:𓂝2 |   | |
| 𓌶:𓂝2𓆄 |   | |
| 𓌻 | 𓌻 |     |
| 𓌻𓀁 | 𓌻𓀁 |  |
| 𓌻𓏭:𓏛1𓀁 | 𓌻 |    |
| 𓌽:𓏥𓏤 |  | |
| 𓍃 | 𓍃 |    |
| 𓍃𓅓𓏭:𓏛 | 𓍃𓅓 |    |
| 𓍊𓏤 | 𓍊𓏤 |     |
| 𓍑 | 𓍑 |                     |
| 𓍑𓄿3 | 𓍑𓄿 |             |
| 𓍑𓍑 | 𓍑𓍑 |     |
| 𓍘 | 𓍘 |  |
| 𓍘1 | 𓍘 |              |
| 𓍘1𓎟:𓏏1 | 𓍘 |        |
| 𓍘𓇋2 | 𓍘𓇋 |    |
| 𓍘𓇋4 | 𓍘𓇋 |     |
| 𓍘𓈖:𓏏 | 𓍘 |  |
| 𓍘𓈖:𓏏1 | 𓍘 |  |
| 𓍣 | 𓍣 |  |
| 𓍦 | 𓍦 |  |
| 𓍩 | 𓍩 |  |
| 𓍬:𓂻':° |  | |
| 𓍯 | 𓍯 |                                    |
| 𓍱 | 𓍱 |    |
| 𓍱1 | 𓍱 |  |
| 𓍱:𓂡1 |  | |
| 𓍱:𓂡1𓏏 |  | |
| 𓍴 | 𓍴 |       |
| 𓍴1 | 𓍴 |  |
| 𓍴1𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖9 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |       |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2 | 𓍴 |    |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓋩2 | 𓍴 |  |
| 𓍸𓏛1 | 𓍸𓏛 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |                                             |
| 𓍺 | 𓍺 |                              |
| 𓍼:𓏤1 |   | |
| 𓍼:𓏥 |  | |
| 𓎃° | 𓎃 |    |
| 𓎆 | 𓎆 |              |
| 𓎇 | 𓎇 |  |
| 𓎈 | 𓎈 |  |
| 𓎉 | 𓎉 |   |
| 𓎔 | 𓎔 |  |
| 𓎔2 | 𓎔 |                |
| 𓎔2: | 𓎔: |          |
| 𓎔:𓏺 |   | |
| 𓎔:𓏻 |      | |
| 𓎔:𓏼 |      | |
| 𓎔:𓏽 |    | |
| 𓎛 | 𓎛 |     |
| 𓎛1 | 𓎛 |  |
| 𓎛2 | 𓎛 |         |
| 𓎛2𓐑:𓊪1𓅆 | 𓎛 |  |
| 𓎛2𓐑:𓊪𓏲1 | 𓎛 |        |
| 𓎛𓂝:𓏏𓄹 | 𓎛 |   |
| 𓎛𓈖:𓂝 | 𓎛 |  |
| 𓎝𓎛 | 𓎝𓎛 |  |
| 𓎟:𓏏 |        | |
| 𓎟:𓏏1 |   | |
| 𓎡 | 𓎡 |                         |
| 𓎡1 | 𓎡 |           |
| 𓎡1:𓇋1𓇋𓀀 |   | |
| 𓎡:𓍘𓇋 |    | |
| 𓎨 | 𓎨 |         |
| 𓎭 | 𓎭 |    |
| 𓎱1 | 𓎱 |    |
| 𓎱1:𓇳 |    | |
| 𓎸 | 𓎸 |   |
| 𓎸1 | 𓎸 |  |
| 𓎸𓅓𓏰:𓇳1 | 𓎸𓅓 |   |
| 𓎼 | 𓎼 |                   |
| 𓏇1 | 𓏇 |   |
| 𓏇1𓇋1 | 𓏇𓇋 |   |
| 𓏌 | 𓏌 |       |
| 𓏌:𓈖 |        | |
| 𓏌:𓈖:° |     | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤 |    | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤@1 |  | |
| 𓏌:𓈖𓏤1𓉐𓏤@1 |    | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤 |   | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤@1 |   | |
| 𓏌:𓏤 |  | |
| 𓏌𓏲1 | 𓏌𓏲 |           |
| 𓏌𓏲2 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏌𓏲𓍖:𓏛 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏎:𓈖 |          | |
| 𓏎:𓈖𓏤 |      | |
| 𓏏 | 𓏏 |                                                                                     |
| 𓏏*𓏤 | 𓏏𓏤 |        |
| 𓏏*𓏰 | 𓏏𓏰 |        |
| 𓏏1 | 𓏏 |                         |
| 𓏏1:° | 𓏏 |  |
| 𓏏:° | 𓏏 |   |
| 𓏏:𓄿 |                                                                       | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |     | |
| 𓏏:𓄿𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑 |    | |
| 𓏏:𓄿𓏭 |        | |
| 𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥 |  | |
| 𓏏:𓆇 |         | |
| 𓏏:𓆇1 |   | |
| 𓏏:𓆑 |    | |
| 𓏏:𓈇𓏤@1 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥:° |    | |
| 𓏏:𓈙 |   | |
| 𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖1 |  | |
| 𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖3 |  | |
| 𓏛 | 𓏛 |    |
| 𓏛𓏏 | 𓏛𓏏 |  |
| 𓏞𓍼:𓏤 | 𓏞 |    |
| 𓏞𓍼:𓏤@ | 𓏞 |         |
| 𓏠:𓈖 |           | |
| 𓏠:𓈖1 |   | |
| 𓏠:𓈖1:° |   | |
| 𓏠:𓈖1:°𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |   | |
| 𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛 |  | |
| 𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |  | |
| 𓏠:𓈖𓐍:𓍊𓏤 |  | |
| 𓏤 | 𓏤 |                                           |
| 𓏤1 | 𓏤 |    |
| 𓏤1𓈘:𓈇 | 𓏤 |  |
| 𓏤𓊖 | 𓏤𓊖 |   |
| 𓏤𓏰:𓇳5 | 𓏤 |           |
| 𓏤𓏰:𓊖1 | 𓏤 |        |
| 𓏤𓏰:𓊖3 | 𓏤 |                       |
| 𓏥 | 𓏥 |    |
| 𓏪 | 𓏪 |                                                                                                                                                |
| 𓏪1 | 𓏪 |                                                                          |
| 𓏪1° | 𓏪 |   |
| 𓏪3 | 𓏪 |                                      |
| 𓏫 | 𓏫 |      |
| 𓏫1:° | 𓏫 |   |
| 𓏫:° | 𓏫 |     |
| 𓏭:𓂢 |     | |
| 𓏭:𓏛 |                                                 | |
| 𓏭:𓏛1 |                           | |
| 𓏰:𓀀 |   | |
| 𓏰:𓇳1 |                 | |
| 𓏰:𓇳1@ |           | |
| 𓏰:𓇳2𓏤2 |       | |
| 𓏰:𓊖2° |    | |
| 𓏲 | 𓏲 |                  |
| 𓏲1 | 𓏲 |        |
| 𓏲2 | 𓏲 |   |
| 𓏲:𓏏 |                     | |
| 𓏲:𓏏𓏤 |       | |
| 𓏲𓏭:𓏛 | 𓏲 |                                             |
| 𓏴:𓂡 |            | |
| 𓏴:𓂡𓍘1 |         | |
| 𓏴:𓏛4 |   | |
| 𓏴:𓏛4𓀁 |   | |
| 𓏶 | 𓏶 |      |
| 𓏶𓅓 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓1 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓𓏭 | 𓏶𓅓𓏭 |    |
| 𓏺 | 𓏺 |      |
| 𓏺:𓏏 |    | |
| 𓏻 | 𓏻 |  |
| 𓏻4 | 𓏻 |  |
| 𓏻:𓏌 |   | |
| 𓏼1 | 𓏼 |              |
| 𓏽1 | 𓏽 |   |
| 𓏾 | 𓏾 |      |
| 𓏾2 | 𓏾 |  |
| 𓏿 | 𓏿 |        |
| 𓐀 | 𓐀 |       |
| 𓐀1 | 𓐀 |  |
| 𓐁 | 𓐁 |     |
| 𓐁1 | 𓐁 |   |
| 𓐁1:𓐋2𓏌𓏲1𓀼 |   | |
| 𓐁:° | 𓐁 |  |
| 𓐂 | 𓐂 |    |
| 𓐅 | 𓐅 |  |
| 𓐆 | 𓐆 |  |
| 𓐇 | 𓐇 |  |
| 𓐈1 | 𓐈 |  |
| 𓐉 | 𓐉 |  |
| 𓐊 | 𓐊 |   |
| 𓐋2 | 𓐋 |   |
| 𓐍 | 𓐍 |               |
| 𓐍:𓂋 |      | |
| 𓐍:𓂋𓀁 |      | |
| 𓐍:𓅓 |     | |
| 𓐍:𓅓𓅪 |  | |
| 𓐍:𓅓𓅪:° |    | |
| 𓐍:𓊪2 |   | |
| 𓐍:𓏏*𓏰 |    | |
| 𓐍:𓏭 |         | |
| 𓐑:𓊪 |       | |
| 𓐑:𓊪1 |  | |
| 𓐑:𓊪𓏲1 |  | |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛 | 𓐠𓏤 |           |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓐠𓏤 |                        |
| 𓐪 | 𓐪 |    |
| 𓐪𓂧:𓏏*𓏰 | 𓐪 |  |
| 𓐪𓏏:𓊌 | 𓐪 |  |
| | |        |
| ⸗y "[Suffixpron. 1. sg. c.]" |             |
| ⸗w; [⸗w]; ⸢⸗w⸣; [[⸗w]] "[Suffixpron. 3. pl. c.]" |                                                                                                                                       |
| ⸗f; [⸗f]; ⸢⸗f⸣ "[Suffixpron. 3. sg. m.]" |                                                                                                                            |
| ⸗n "[Suffixpron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸗s; ⸢⸗s⸣ "[Suffixpron. 3. sg. f.]" |                                  |
| ⸗k "[Suffixpron. 2. sg. m.]" | 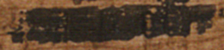       |
| ⸗tn "[Suffixpron. 2. pl. c.]" |    |
| ꜣwy "Lobpreis" |  |
| ꜣbḫ "vergessen" |  |
| ꜣbd "Monat" |   |
| ꜣbd-1 "Monat 1" |   |
| ꜣbd-2 "Monat 2" |     |
| ꜣbd-3; ⸢ꜣbd-3⸣ "Monat 3" |        |
| ꜣbd-4 "Monat 4" |   |
| ꜣbdy "Neulicht, zweiter Tag des Mondmonats" |   |
| ꜣfꜥ(.t); ꜣfꜥ(.w) "gierig [Adjektiv]" |   |
| ꜣrwy "Stengel, Stoppel, Spreu" |   |
| ꜣḥ.w "Acker" |  |
| ꜣḫ(.t) "Überschwemmungsjahreszeit, Achet" |     |
| ꜣs(.t) "Isis [GN]" |   |
| ꜣsḳ "zögern" | 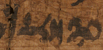 |
| ꜣgy "tüchtig, vorzüglich, vortrefflich" | 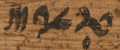 |
| ꜣḏꜣ(.t) "Hacke" | 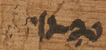 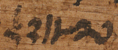 |
| ỉ.ỉr-ḥr; ỉ:ỉr-ḥr "vor, bei, zur Zeit von [Präp.]" |    |
| ỉ.ḳd "Baumeister" |  |
| ỉꜣw.t "Amt, Würde" |    |
| ỉꜣw.t-(n)-ḥrỉ "Herrscheramt" |    |
| ỉꜣb.tỉ "Osten" |  |
| ỉ:ỉri̯ "[Konverter 2. Tempus]" |      |
| ỉ:ỉri̯; (ỉ:)ỉri̯ "[Bildungselement des Partizips]" |                |
| ỉ:ỉri̯⸗f "[Konverter 2. Tempus + Suffixpron. 3. sg. m.]" | 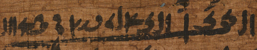   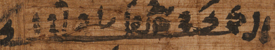      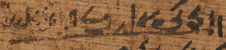 |
| ỉyi̯ "kommen" |            |
| ỉꜥḥ "Mond" |  |
| Ỉꜥḥ-ms; 𓍹Ỉꜥḥ-ms; 𓍹Ỉꜥḥ-ms ꜥ.w.s; Ỉꜥḥ-ms ꜥ.w.s "Amasis [KN]" |       |
| ỉw; [ỉw] "[Bildungselement des Futur III]" |                                                            |
| ⸢ỉw⸗w⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. pl. c.]" |   |
| ỉw⸗f "er [proklit. Pron. 3. sg. m.]" |     |
| ỉw⸗f "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗f "wenn er [Konditionalis + Suffixpron. 3. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗f; ỉw⸗f(?) "indem er [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗s "sie [proklit. Pron. 3. sg. f.]" |      |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. f.]" |       |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣; ⸢ỉw⸣⸗s "indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. f.]" |           |
| ỉw⸗k "du [proklit. Pron. 2. sg. m.]" |   |
| ỉw⸗k "indem du [Umstandskonverter + Suffixpron. 2. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗k "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉw⸗k "[Konditionalis + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉwi̯ "kommen" |   |
| ỉwỉw.w; ỉwỉw "Hund" |   |
| Ỉwnw "Heliopolis [ON])" | 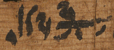 |
| ỉwr "schwanger werden" |  |
| ỉb "Herz" |  |
| ỉbỉ "Honig" |   |
| ỉp "zählen" |     |
| ỉpe.t; ỉpe(.t); ỉp(.t) "Arbeit" |        |
| ỉpre "Sproß, Samen, Korn" |  |
| ỉpt "Tafel" |  |
| ỉpd.w; ỉpd; ỉpd(.w) "Geflügel, Gans, Vogel" |    |
| ỉmn "Amun [GN]" |   |
| ỉmn.tỉ "Westen" |  |
| Ỉmn-ỉ:ỉri̯-ḏi̯.t-s "Amyrtaios [KN]" | 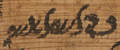  |
| ỉn "[Fragepartikel]" |  |
| ỉn; ⸢ỉn⸣ "[Postnegation]" |     |
| ỉn-nꜣ.w "wenn [Bildungselement Konditionalis]" |  |
| ỉni̯ "holen, bringen" |        |
| ỉne "Stein" |    |
| ỉr.t "Auge" |   |
| ỉrỉ "Gefährte" |  |
| ỉri̯; {ỉri̯}; ỉri̯ (?); ỉ:ỉri̯ "tun, machen" |                                                 |
| ỉri̯⸗f "[Verb + Suffixpron. 3. sg. masc.]" |      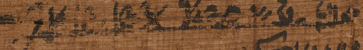   |
| ỉri̯-ḥrỉ "Herrschaft, Regierung" |        |
| ỉri̯-sh̭y "Macht haben über, verfügen über" |  |
| ỉrpy; ỉrp⸢y⸣.w; ỉrpy.w; ỉrpꜣ; ỉrpꜣ.w; ⸢ỉrpꜣ⸣.w; ỉrpꜣ(.w); ⸢ỉrp⸣ "Tempel" |                 |
| ỉrm "mit, und [Präp.]" |       |
| ỉrm pꜣ ḫpr ꜥn "und ferner" | 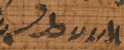 |
| ỉḥ.w "Rind" |   |
| ỉḥ.t "Kuh" |  |
| ỉšr "Syrer, Assyrer" |  |
| ỉṱ "Vater" |    |
| ỉt "Gerste" |  |
| yꜥr "Fluß, Kanal" | 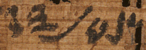 |
| yꜥr-ꜥꜣ "'großer Fluß', Nil" | 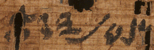 |
| Ybyꜣ "Elephantine [ON]" | 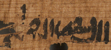 |
| [ꜥ].wỉ; ꜥwỉ.w; ꜥ.wỉ "Haus, Platz" |     |
| ꜥ.wỉ-(n)-wpy "Haus des Richtens, Gericht" |  |
| ꜥꜣ "Art, Zustand" |  |
| ꜥꜣ; ꜥy.w; ⸢ꜥy.w⸣ "groß [Adjektiv]" |      |
| ⸢ꜥy.w-(n)-ms⸣ "alt sein, alt werden" |  |
| ꜥw; ꜥꜣ; ꜥy "groß sein [Adjektivverb]" |     |
| ꜥw-n-ỉr.t "Glück" |  |
| ꜥby.t "Spende, Opfer" | 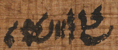 |
| ꜥn; ⸢ꜥn⸣ "erneut, wieder [Adverb]" |        |
| ꜥnḫ "leben" |     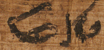  |
| ꜥnḫ "Leben" |  |
| ꜥrꜥy(.t); ꜥry(.t) "Uräusschlange" |        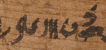 |
| ꜥrwy "vielleicht [Adv.]" | 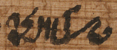 |
| ꜥrḳy "letzter Monatstag" |      |
| ꜥrḏ "Sicherheit, Festigkeit" |  |
| ꜥḥꜥ "stehen" |     |
| ꜥḫ "Feuerbecken, Ofen" |    |
| ꜥš "rufen" |    |
| ꜥš-šlly "flehen" |  |
| ꜥšꜣ "zahlreich sein [Adjektivverb]" |   |
| ꜥšꜣ "zahlreich [Adjektiv]" |  |
| ꜥḳ "Brot, Ration" |     |
| wꜣḥ-sḥn "befehlen" |  |
| wyꜥ "Bauer" | 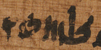 |
| Wynn.w; Wynn(.w) "Grieche" |   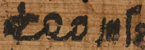 |
| wꜥ.t; wꜥ "eine" |      |
| wꜥb "Reinheit; Reinigung" |  |
| wꜥb; wꜥb.w "Priester" |         |
| wꜥb.w; wꜥb "rein sein, unbelastet sein" |        |
| wꜥb.t "Balsamierung, Tod" |  |
| wbꜣ "gegenüber [Präp.]" |  |
| wpy "öffnen, trennen, richten" |  |
| wn "öffnen" |            |
| wn "sein, existieren" |    |
| Wn-h̭m "Wenchem [ON]" |  |
| wnm "rechts, rechte Seite" |    |
| wnm "essen" |      |
| wnty.w "Kurzhornrind, Opfertier " |  |
| wr<š>e "Altlicht; Mondmonat" |   |
| whꜥ "böse Tat, Sünde, Verfehlung" |  |
| wṱ "Befehl, Erlass, Dekret" |  |
| bỉk.w "Falke" |  |
| bw-ỉri̯; ⸢bw⸣-ỉri̯ "[Negation des Aorists]" |         |
| bw-ỉri̯-tw "noch nicht [neg. Perfekt]" |  |
| bn "[Negation]" |  |
| bn.ỉw "[Negation Futur III]" |     |
| bn.ỉw "[Negation Präsens I]" |    |
| bn-p "[Negation Vergangenheit]" |             |
| bnr "Außen, Außenseite" |  |
| blꜣ "lösen" |  |
| bš "entblößen, verlassen, reduzieren" |  |
| bgs "sich empören, rebellieren" |  |
| btw "Strafe" | 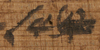    |
| bd(.t) "Emmer" |   |
| p.t; p(.t) "Himmel" |   |
| pꜣ; ⸢pꜣ⸣ "der [def. Art. sg. m.]" |                                                                                                                                                         |
| pꜣ tꜣ (n) rsỉ "Südland" |  |
| pꜣ tꜣ (n) ẖr "Syrerland, Syrien [ON]" |   |
| pꜣ-bnr-n; pꜣ-bnr-(n) "außer, außerhalb [Präp.]" |   |
| pꜣ-hrw "heute, jetzt [Adverb]" |     |
| Pꜣ-šrỉ-Mw.t "Psammuthis [KN]" |  |
| pꜣỉ "[def. Art. sg. m. + Präfix der Relativform]" |   |
| pꜣỉ "dieser [Demonstrat. sg. m.]" |  |
| pꜣỉ; ⸢pꜣỉ⸣ "[Kopula sg. m.]" |                                     |
| pꜣy⸗w "ihr" |    |
| pꜣy⸗f; ⸢pꜣy⸗f⸣ "sein" |                               |
| pꜣy⸗k "dein" |  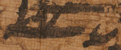   |
| ⸢pa⸣; pa "der von" |       |
| Py "Pe, Buto [ON]" | 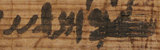  |
| py "Thron" |  |
| pr.w; pr "Haus" |   |
| pr(.t) "Aussaat-Zeit, Peret, Winter" |       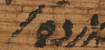     |
| pr-ꜥꜣ "König" |             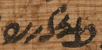           |
| pr-pr-ꜥꜣ "Königspalast" |  |
| Pr-nb(.t)-ṱp-ỉḥ "Aphroditopolis, Atfih [ON]" | 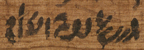 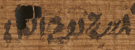 |
| pri̯ "herauskommen" |  |
| prt.w; prt "Saatgut, Getreide" |   |
| prḏꜣ "Kinn(?)" | 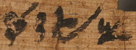 |
| pḥ "erreichen, ankommen" |       |
| pẖrꜣ "herumgehen, durchziehen" | 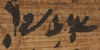 |
| pẖry.w(t); pẖry(.t) "Medikament, Zaubermittel" |    |
| pš.t "Hälfte" |  |
| Ptḥ "Ptah [GN]" |    |
| m-ỉri̯ "[Negierung des Imperativs]" |    |
| m-sꜣ; m-sꜣ⸗ "hinter [Präp.]" |                         |
| m-ḳdy; ⸢m⸣-ḳdy; m-ḳde "in der Art von [Präp.]" |    |
| m-tw⸗ "bei, jemanden gehören [Präp.]" |      |
| m-tw⸗ "durch [Präp.]" |  |
| m-ḏr; (n)-ḏr.ṱ⸗ "bei, durch [Präp.]" |   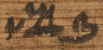    |
| mꜣỉ.w(t) "Insel" |  |
| mꜣꜥ.w; mꜣꜥ "Ort, Platz" |   |
| mꜣḫe.t; mꜣḫe(.t) "Waage" |   |
| mỉ(.t); mỉ.t "Straße" |  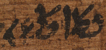 |
| my "[enklitische Partikel nach dem Imperativ]" |  |
| my; ⸢m⸣y; ⸢my⸣; me "[Imperativ von ḏi̯.t]" |    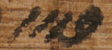     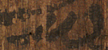 |
| myt "Weg, Rechtsanspruch" |   |
| mꜥḏy "Profit" | 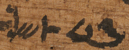  |
| mw "Wasser" |    |
| Mw(.t) "Mut [GN]" |     |
| ⸢mwt⸣; mwt "sterben" |   |
| mn; bn.ỉw "es gibt nicht [Negation der Existenz]" |       |
| [Mn]-nfr; Mn-nfr "Memphis [ON]" |    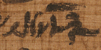 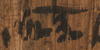 |
| mnḫ "tugendhaft, wohltätig sein [Adjektivverb]" | 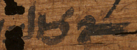   |
| mnḫ "Wohltat, gute Tat" |  |
| mnḳ "Vollendung" |    |
| mnḳ "vollenden" |   |
| mr.t "Liebe, Beliebtheit, Wunsch, Wille" |  |
| mri̯; mri̯.ṱ⸗ "lieben, wünschen" |    |
| mlẖ "Streit" |  |
| mḥ "füllen" |         |
| mḥ-10.t "zehntes" |  |
| mḥ-11 "elftes" |  |
| mḥ-12 "zwölftes" |  |
| mḥ-13 "dreizehntes" |  |
| [mḥ-14] "vierzehntes" | |
| mḥ-2 "zweiter" |      |
| mḥ-3 "dritter" |      |
| mḥ-4 "vierter" |    |
| mḥ-5 "fünfter" |    |
| mḥ-6 "sechster" |    |
| mḥ-7.t; mḥ-7 "siebtes" |    |
| mḥ-8.t "achtes" |  |
| mḥ-9.t "neuntes" | 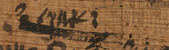 |
| mḥe.w "Flachs" |  |
| mh̭y "gleichen, vergleichen" |  |
| mh̭y; [m]h̭y; mh̭⸢y⸣ "schlagen" |    |
| ms.t; ⸢ms⸣ "Geburt" | 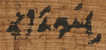  |
| msḥ.w "Krokodil" | 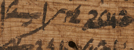 |
| mšꜥ "Armee, Volksgruppe, Menge" |   |
| mšꜥ "gehen, marschieren" |   |
| mtỉ "Flut, Wasser" | 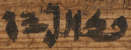 |
| mtw "[Bildungselement des Konjunktivs]" |       |
| mtw⸗s "[selbst. Pron. 3. Sg. f.]" |  |
| mtr "Zeuge sein, zugegen sein" |  |
| md.w(t); md(.t); ⸢md(.t)⸣ "Rede, Wort, Sache, Angelegenheit" |          |
| Mdy.w; Mdy⸢.w⸣; Mdy(.w) "Meder, Perser" | 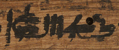 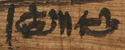          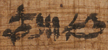 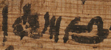  |
| n; ⸢n⸣ "des [Genitiv]" |                  |
| n; n.ỉm⸗; ⸢n.ỉm⸗⸣; {r} <n> "in (< m) [Präp.]" |                                                                |
| n; n⸗ "zu, für (< n; Dativ)" |                          |
| n.ỉm "dort [Adverb]" |   |
| n.n⸗w "für sie" |                |
| n⸗k "für dich" |  |
| (n)-wꜥ-sp "alle zusammen" |  |
| (n)-bnr "außen, draußen [Adverb]" |  |
| (n)-rn; (n)-rn⸗; ⸢(n)-rn⸣; (n-)rn "besagter, betreffender" |         |
| (n)-tꜣ-ḥꜣ.t "früher, vorne [Adverb]" |       |
| (n)-ṯꜣi̯-(n) "von ... an, seit [Präp.]" |  |
| n-ḏr(.t) "als, nachdem [Temporalis]" |        |
| nꜣ; ⸢nꜣ⸣ "die [def. Art. pl. c.]" |                                                                                                                     |
| nꜣ.w "[def. Art. pl. c. + Präfix der Relativform]" |      |
| nꜣ.w "[Kopula Plural]" |       |
| nꜣ.w; n⸗ỉ "für mich" |   |
| nꜣ.w-wn-nꜣ.w "[def. Artikel pl. c. + Präfix der Relativform + Imperfektkonverter]" |  |
| nꜣ-ꜥn; ꜥn "schön sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣ-nḏm; nḏm "angenehm sein, froh sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣy "diese [Demonstrat. pl. c.]" |    |
| nꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| nꜣy⸗w "ihre" |     |
| nꜣy⸗f "seine" |     |
| Nꜣy⸗f-ꜥw-rd.wỉ "Nepherites [KN]" |  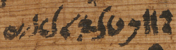 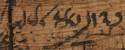 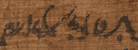  |
| nꜣy⸗n "unsere" |   |
| nꜣy⸗s "ihre" |  |
| nꜣy⸗k "deine" |  |
| nw "sehen" |     |
| nwḥ; ỉn.nwḥ "Strick" |     |
| nb "Gold" |   |
| ⸢nb⸣ "jeder; irgendein" |  |
| nb; nb.w "Herr" |    |
| nb.t "Frevel, Sünde" |  |
| nb(.t); nb.t "Herrin" |   |
| nb-n-ḫꜥi̯ "Herr der Erscheinungen" |  |
| nfr "gut sein [Adjektivverb]" |   |
| nfr "gut [Adjektiv]" |  |
| nmꜣy(.t)(?) "'Wanderin' (?)" |   |
| nhe(.t) "Sykomore" |  |
| nḫ(?)(.t) "Klage, Totenklage" | 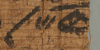 |
| nḫby(.t) "Königstitulatur" | 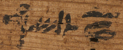 |
| Nḫṱ-nb⸗f "Nektanebos I. [KN]" |  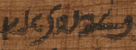 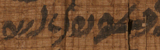 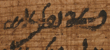     |
| nsw "König" |  |
| nkt "Sache" |        |
| nkt-ḥwrꜥ "Raubgut" |  |
| ntỉ; ⸢ntỉ⸣ "[Relativkonverter]" |                                                                      |
| ntỉ.ỉw "[Relativkonverter]" |                  |
| ntỉ.ỉw⸗f "[Relativkonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |  |
| ntỉ.ỉw⸗k "[Relativkonverter + Suffixpron. 2 sg. m.]" |  |
| ntỉ-ỉri̯ "[Relativkonverter + r im Futur III vor nominalem Subjekt]" |  |
| ntỉ-wꜥb "Sanktuar" |     |
| nṯr "Gott" |      |
| nṯr.w; nṯr⸢.w⸣ "Götter" |            |
| r "[im Futur III vor nominalem Subjekt]" |       |
| r "[im Futur III vor Infinitiv]" |            |
| r "macht (bei Beträgen u.ä.)" |     |
| r; ỉw; ⸢ỉw⸣ "indem, wobei [Umstandskonverter]" |                  |
| r; [r]; r.ḥr⸗ "zu, hin [Präp.]" |                                        |
| r.r⸗w "zu ihnen" |     |
| ⸢r⸣.r⸗f "zu ihm" |  |
| r.r⸗k "zu dir" |   |
| r-wbꜣ "gegen, gegenüber, vor [Präp.]" |    |
| r-bw.nꜣỉ "hierher [Adverb]" |  |
| r-bnr "heraus [Adverb]" |  |
| r-hn "bis hin zu [Präp.]" |   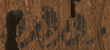 |
| r-ḥr "auf, vor [Präp.]" |  |
| r-ẖ(.t) "in der Art von, entsprechend [Präp.]" |    |
| (r)-šw "überhaupt; wieder, jemals" |  |
| (r)-ḏbꜣ; (r)-ḏbꜣ⸗; ⸢(r)-ḏbꜣ⸣ "wegen [Präp.]" | 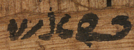    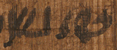  |
| Rꜥ "Re [GN]" |      |
| r:wn-nꜣ.w-⸢ỉw⸗⸣; r:wn-nꜣ.w; (r:)wn-nꜣ.w "[Präfix der Relativform + Imperfektkonverter]" |      |
| rmy "weinen, beweinen" | 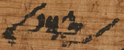  |
| rmy(.t) "Träne" |  |
| rmṯ; rmṯ.w "Mensch, Mann" |            |
| rmṯ.w-rḫ.w "Gelehrter" |  |
| rmṯ-(n)-ḳnḳn; rmṯ.w-(n)-ḳnḳn "Krieger" |   |
| rn "Name" |    |
| rnp(.t); rnp.w(t) "Jahr" |           |
| rḫ; ỉr.rḫ "wissen, können" |   |
| rsỉ "Süden" |  |
| rše; ršy "sich freuen" | 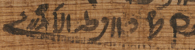  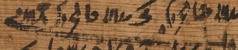  |
| ršy "Freude" |  |
| (r:)ḳd "bauen" |  |
| rd.wỉ "Fuß" |  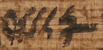  |
| lk "aufhören, beseitigen" |        |
| <mḥ-1>; mḥ-1 "erster" |   |
| <3.nw> "dritter" | |
| hꜣ; ⸢h⸣[ꜣ] "Zeit" |               |
| hb "senden, schicken" |  |
| ⸢hp⸣; hp "Recht, Gesetz, Gesetzanspruch" |              |
| hri̯.w "zufrieden sein, besänftigt sein" |  |
| hrw "Tag" |  |
| Hgr; Hḳr "Hakoris [KN]" |  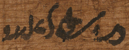 |
| htmꜣ "Thron" |  |
| ḥꜣ(.t) "vor [Präp.]" |   |
| ḥꜣ.t; ḥꜣ(.t) "Vorderteil, Anfang, Spitze" |     |
| ḥꜣ.tỉ; ḥꜣ.tỉ⸗ "Herz" |       |
| ḥꜣṱ; ḥꜣṱ.t "erster, früherer [Adjektiv]" |   |
| ḥꜥ⸗ "selbst" |   |
| ḥw "Vermehrung, Profit" |  |
| ḥw.ṱ "Ackerbauer" |  |
| Ḥw.t-nn-nsw; Ḥw.t-(nn)-nsw "Herakleopolis [ON]" |    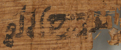   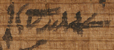   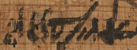 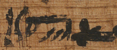 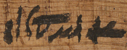 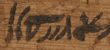  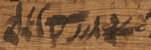  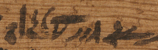 |
| ḥw(.t)-nṯr "Tempel" |    |
| ḥwe(.t); ḥwe.t; ⸢ḥwe⸣[.t] "Kapitel, Strophe" |         |
| ḥwy "Regen" |   |
| ḥwy "schlagen, werfen" |  |
| ḥwrꜥ "rauben, berauben" |   |
| ḥwrꜥ; ḥwrꜥ(.w) "Raub, Räuberei" |    |
| ḥwṱ "Mann, männlich" |  |
| ḥbs "bekleiden, bedecken" | 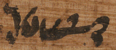 |
| ḥbs.w "Kleidung" |  |
| Ḥp "Apisstier [GN]" |         |
| ḥm.t "Frau, Ehefrau" |  |
| ḥm-nṯr; ⸢ḥm-nṯr(?)⸣ "Gottesdiener, Prophet" |     |
| ḥmꜣ.t "Gebärmutter" |   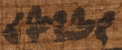 |
| ḥn; (r:)ḥn "befehlen" |         |
| ḥnꜥ "und, zusammen mit, oder [Präp.]" |  |
| ḥr "auf [Präp.]" |           |
| ḥr-ꜣt⸗ "auf [Präp.]" | 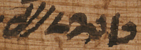 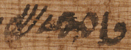 |
| Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) "Horus, Sohn der Isis [GN]" |    |
| Ḥr-šf "Herischef [GN]" |      |
| ḥrỉ "oben [Adverb]" |       |
| ḥrỉ "Oberster, Herr, Vorgesetzter" |                                           |
| ḥrḥ "wachen, hüten" |  |
| ḥlly; ḥll "Trübung, Finsternis (?)" | 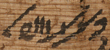  |
| ḥsb(.t); ⸢ḥsb(.t)⸣ "Regierungsjahr" |      |
| ḥḳr; ḥḳꜣ "hungern" |     |
| ḥtp-nṯr "Gottesopfer" |  |
| ḥḏ; ḥḏ.w "Silber, Geld" |    |
| ḥḏ.t "Weiße Krone" |  |
| ḫꜣ "Meßstab" |   |
| ḫꜣꜥ "werfen, legen, lassen, verlassen" |          |
| ḫꜣsy(.t); ḫꜣs.w(t); ḫꜣs(.wt) "Fremdland, Wüste, Nekropole" |        |
| h̭yh̭e "Staub" |  |
| ḫꜥ "Fest" |  |
| ḫꜥi̯ "erscheinen" |     |
| h̭wy "Weihrauch" |  |
| ḫby "vermindern, abschneiden, rasieren" |  |
| ḫpr "geschehen" |                                                    |
| ḫpr "es ist so (dass), denn, weil [Konjunktion]" |        |
| ḫpš; ḫbš "Sichelschwert" |    |
| ḫm.w "klein, jung [Adjektiv]" |  |
| ḫm-ẖr.w; ḫm-ẖr(.w) "Knabe, junger Mensch, Bursche, Kind" | 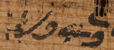 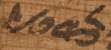   |
| Ḫmnw "Hermopolis [ON]" |  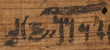 |
| ḫnṱ "stromauf fahren" |   |
| ḫr "[Präfix des Aorists]" |      |
| ḫrw "Stimme" |  |
| ḫštrpn "Satrap" | 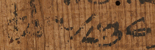 |
| ḫt(.w); ḫt "Holz, Bäume" |      |
| ẖ(.t) "Kopie, Abschrift, Wortlaut" |  |
| ẖ(.t); ẖ.w(t) "Leib, Körper" |   |
| ẖꜣ(.t) "Gemetzel" |     |
| ẖꜥ.t "Ende" |  |
| ẖn; ẖn⸗ "in [Präp.]" | 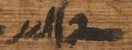       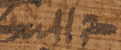    |
| H̱nm "Chnum [GN]" | 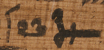  |
| ẖr "Syrer" |   |
| ẖr; ẖr.r.ḥr⸗ "unter, wegen [Präp.]" |   |
| ẖr.t "Speise, Nahrung" |  |
| ẖr-nṯr "Steinmetz" |   |
| ẖrꜣ(.t) "Gewand, Riemen" | 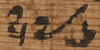 |
| ẖry.w; ẖry "Straße, Weg" |  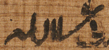 |
| ẖry.t "Witwe" |  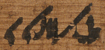 |
| s; st; ⸢s⸣ "[enklit. Pron. 3. sg. m.]" |                           |
| s.t "Platz, Ort" |  |
| sꜣ "Phyle" |    |
| sỉ-n-ꜥḳ "Bäcker" |   |
| sꜥnḫ "ernähren, leben lassen" |  |
| sw "Monatstag" |            |
| sw-10 "Dekade" |    |
| swr "trinken" |  |
| sbꜣ.w "Tür" |   |
| sbḳ(.w) "klein, gering [Adjektiv]" |  |
| sbt "herrichten, ausrüsten, vorbereiten, versorgen" |  |
| sp "Rest" |     |
| sp "Fall, Angelegenheit, Mal" |   |
| sp-2 "zweimal [Wiederholungszeichen]" |   |
| sf "gestern [Adverb]" |   |
| s[fy] "Messer, Schwert" |  |
| smn "aufsetzen, feststellen, dauern (lassen)" |  |
| smḥ (?) "links" |    |
| smt; [s]mt "Art, Weise, Gestalt" |      |
| sn.w "Bruder" |  |
| ⸢s⸣nty "sich fürchten" |  |
| sḥm.t "Frau" |  |
| sḥn "Krone, Diadem" |   |
| sḥn "Angelegenheit, Amt, Befehl, Auftrag" |  |
| sḥn.ṱ; sḥn "befehlen, beauftragen" |   |
| sḫ(.t) "Feld" |  |
| sẖꜣ "Schrift" |  |
| sẖꜣ; ⸢sẖꜣ⸣ "schreiben" |          |
| sẖꜣ.w "Schreiber" |  |
| sẖꜣ-ỉšr "syrische Schrift, Aramäisch" |  |
| ssw; ss.w; ⸢ss.w⸣ "Termin, Zeit" |             |
| sḳꜣ "zusammenfügen, sammeln" |  |
| sgrꜣ.w "Herde (o.ä.)" |  |
| st "[enklit. Pron. 3. pl. c.]" |  |
| stbḥ(.t) "Gerät, Waffe" |  |
| stbḥ(.t)-n-ḳnḳn "Kampfgerät, Waffen" |  |
| sṯꜣ.ṱ "(sich) zurückziehen, wenden" |  |
| sdb "essen" |  |
| sḏm "hören" |  |
| sḏny "beraten" |  |
| šy(.w) "See" |  |
| šw "Wert, Nutzen" |  |
| šbi̯.t "Veränderung, Tausch, Entgelt" |   |
| ⸢šm⸣; šm "gehen" |               |
| šm.w "Gang, Reise" |  |
| šmsi̯(?); šmsi̯ "folgen, dienen, geleiten" |     |
| šn "Krankheit" |  |
| šn.w "Inspektion, Untersuchung" |  |
| šni̯ "fragen, suchen, untersuchen" |       |
| šni̯ "krank sein" |  |
| šnꜥ "abweisen, abhalten" |  |
| šnt(.t); ⸢šnt(.t)⸣ "Schurz, Tuch" |   |
| šrỉ "Sohn" |        |
| šll "beten, flehen" | 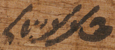 |
| šlly "Wehruf, Wehklage" | 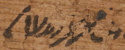 |
| šsp; ⸢šsp⸣ "empfangen" |      |
| šty "(Priester)einkommen" |  |
| ⸢št⸣y.w "Wald, Busch" |  |
| ḳb "verdoppeln" |  |
| ḳbꜣ(.t) "Gefäß, Krug" |  |
| ḳn "Stärke, Sieg" |  |
| ḳnḥ.t "Schrein, Naos" | 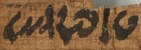 |
| ḳnḳn "schlagen, kämpfen" |    |
| ḳlꜣ.t; ḳlꜣ.w(t) "Riegel, Zapfen" |   |
| ḳd(.t) "Kite (1/10 Deben)" |  |
| ḳdy "umherziehen" |  |
| k.ṱ.t "andere [sg. f.]" |   |
| kꜣm "Garten" | 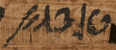 |
| kꜣmy "Gärtner, Winzer" |  |
| kỉỉ.w; kỉỉ "anderer [sg. m.]" |   |
| Kbḏe; Kbḏ "Kambyses [KN]" | 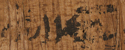  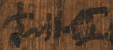    |
| Km; ⸢Km⸣ "Ägypten" |                    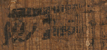  |
| kṱ.t-ẖ(.t) "andere [pl. c.]" |  |
| gy "Gestalt, Art" |  |
| gbꜣ.t "Sproß, Blatt, Nachkommenschaft" | 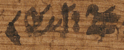 |
| gby.w "Schwacher" |  |
| gmi̯ "finden" |       |
| grp "öffnen, enthüllen, offenbaren" |  |
| glw "deponieren, anvertrauen" |  |
| gsgs "tanzen" |  |
| gst "Palette" |   |
| gḏwḏꜣ "Mensch aus Gaza, Diener" | 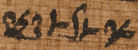 |
| tꜣ "Land, Welt, Erde" |       |
| tꜣ; ⸢tꜣ⸣ "die [def. Artikel sg. f.]" |                                                      |
| Tꜣ-Mḥy "Unterägypten" |  |
| Tꜣ-Šmꜥ "Oberägypten [ON]" |   |
| tꜣỉ "[Kopula sg. f.]" |        |
| tꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| ⸢tꜣy⸗w⸣ "ihre" |  |
| tꜣy⸗f "seine" |     |
| tꜣy⸗s "ihre" |    |
| tꜣy⸗k "deine" |     |
| ta "die von" |  |
| Ta-bꜣ.ỉyi̯ "Tabis(?)" | 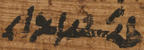 |
| tw⸗ỉ "[proklit. Pron. 1. sg. c.]" |   |
| tw⸗n "[proklit. Pron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸢tw⸣⸗tn "[proklit. Pron. 2. pl. c.]" |  |
| twꜣ "Berg" |  |
| twtw "sammeln, sich versammeln" |  |
| tp.t; tp "erster [Adjektiv]" |   |
| tpy.t "Anfang" | 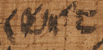 |
| tfy "wegnehmen, entfernen" |  |
| tm "[Negationsverb]" |    |
| tm-hp "Unrecht" |  |
| Tryꜣwš "Dareios [KN]" |  |
| ṱrry "Ofen" |  |
| tḥ⸢ꜣ⸣ "Bitternis, Leiden, Krankheit" |  |
| tḥꜣ "betrübt sein, bitter sein, krank sein" |  |
| ṱḥs "salben" | 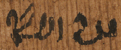 |
| tḫ(?)s(.t) "?" |  |
| tš; ⸢tš⸣.w "Bezirk, Provinz" |   |
| ṱkn "nahe kommen, eilen" |   |
| tgs.w; tgs "Bauholz" |     |
| ṯꜣi̯ "nehmen, empfangen" |     |
| dp-n-ỉꜣw.w(t) "Vieh" |  |
| Dpꜣy; Dpꜣ; Dpyꜣ "Dep (Stadtteil von Buto) [ON]" |    |
| dmḏ "Summe" |         |
| dnỉ(.t) "Anteil" |  |
| dšry(.t) "Rote Krone" |  |
| ḏꜣḏꜣ "Kopf" |     |
| ḏi̯; ḏi̯.t; ḏi̯⸗; ⸢ḏi̯.t⸣ "geben" |                                                     |
| ḏi̯.t st; ⸢ḏi̯.t st⸣ "[Infinitiv + enklit. Pron. 3. pl. c., Haplographie]" |         |
| ḏwf "Papyrus (Pflanze)" |  |
| ḏm "Geschlecht, Nachkomme, Generation; Jungmannschaft; Kalb" |  |
| ḏmꜥ; ḏm⸢ꜥ⸣ "Papyrusrolle, Buch" |     |
| ḏmꜥy "trauern, klagen" | 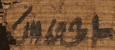 |
| ḏn⸢f⸣; ḏnf "Gewicht, Maß, Gleichgewicht" |   |
| ḏr(.t); ḏr(.t)⸗ "Hand" |    |
| ḏr⸗ "ganz, alle" |    |
| ḏrꜣ; ḏ⸢r⸣ꜣ "stark, siegreich sein [Adjektivverb]" |     |
| ḏlḏ "Pflanzung, Hecke (?)" |   |
| Ḏḥw.tỉ "Thot [GN]" |   |
| Ḏd "Djed-Pfeiler" |   |
| ḏd; ⸢ḏd⸣ "[Konjunktion]" |                                                                                                        |
| ḏd.ṱ; ḏd; (r:)ḏd "sagen, sprechen" |                              |
| Ḏd-ḥr "Tachos, Taos [KN]" | 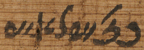 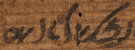 |
| 1; (sw)-1 "Tag 1" |     |
| 10 "10" |  |
| 13 "13" |  |
| 16 "16" |   |
| 160.532 "160.532" | 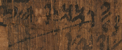 |
| 170.210 "170.210" |  |
| 18 "18" |   |
| 19 "19" | 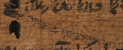  |
| 2 "(Tag) 2" |  |
| 2.nw; {2.nw} "zweiter" |   |
| 27 "27" |  |
| 3 "(Tag) 3" |  |
| 3; 3.t "3" |            |
| 376.800 "376.800" |  |
| 4 "(Tag) 4" |  |
| 44; 44.t "44" |   |
| 5 "(Tag) 5" |  |
| 5.t; 5 "5" |    |
| 6 "(Tag) 6" |  |
| 6 "6" |   |
| 6.000 "6.000" |  |
| 7 "7" |  |
| 7; (sw)-7 "(Tag) 7" |   |
| 8 "8" |   |
| 𓂞'𓏲 | 𓂞𓏲 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |  |
| :**𓅓1𓄿1** | :𓅓𓄿 |  |
| :𓎆 | :𓎆 |    |
| :𓏾 | :𓏾 |  |
| :𓐀 | :𓐀 |  |
| :𓐂 | :𓐂 |  |
| 𓀀1 | 𓀀 |    |
| 𓀀3 | 𓀀 |      |
| 𓀀:𓈖 |   | |
| 𓀁 | 𓀁 |                                                                                                                           |
| 𓀁1 | 𓀁 |  |
| 𓀁° | 𓀁 |                             |
| 𓀋:° | 𓀋 |  |
| 𓀎 | 𓀎 |   |
| 𓀎𓏰:𓀀𓀁 | 𓀎 |   |
| 𓀐 | 𓀐 |                                                             |
| 𓀐1 | 𓀐 |   |
| 𓀔 | 𓀔 |                               |
| 𓀗 | 𓀗 |       |
| 𓀙 | 𓀙 |    |
| 𓀙𓇋𓏲 | 𓀙𓇋𓏲 |    |
| 𓀞 | 𓀞 |  |
| 𓀢2 | 𓀢 |  |
| 𓀨 | 𓀨 |   |
| 𓀹1 | 𓀹 |  |
| 𓀼 | 𓀼 |   |
| 𓀾1 | 𓀾 |   |
| 𓁀:𓂡 |   | |
| 𓁀:𓂡𓍱 |  | |
| 𓁐9 | 𓁐 |      |
| 𓁗1 | 𓁗 |   |
| 𓁗1:° | 𓁗 |  |
| 𓁶𓏤1 | 𓁶𓏤 |      |
| 𓁶𓏤1𓊪1 | 𓁶𓏤𓊪 |  |
| 𓁶𓏤1𓊪1:° | 𓁶𓏤𓊪 |    |
| 𓁷𓏤 | 𓁷𓏤 |                               |
| 𓁷𓏤1𓀀3 | 𓁷𓏤𓀀 |   |
| 𓁹:𓂋*𓏭 |                                                                                                 | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑 |                   | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑1 |    | |
| 𓁹:𓏏*𓏤𓁻1 |   | |
| 𓁻2 | 𓁻 |   |
| 𓁻:° | 𓁻 |                   |
| 𓂊2:° | 𓂊 |   |
| 𓂋 | 𓂋 |                   |
| 𓂋1 | 𓂋 |                                                                                                                 |
| 𓂋1𓂋:𓆑 | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓎡° | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓏥𓏲 | 𓂋 |     |
| 𓂋3𓌥 | 𓂋𓌥 |           |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1'𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲 |   |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲𓏲 |       |
| 𓂋3𓌥𓃀𓏲1𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲𓏲 |  |
| 𓂋3𓌥𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓏲 |  |
| 𓂋:𓂋 |    | |
| 𓂋:𓂧 |      | |
| 𓂋:𓂧:° |  | |
| 𓂋:𓂧:°𓌗1 |  | |
| 𓂋:𓂧@ |   | |
| 𓂋:𓂧@𓂾𓂾 |   | |
| 𓂋:𓂧𓂾𓂾 |  | |
| 𓂋:𓂧𓌗1 |    | |
| 𓂋:𓂧𓌗2 |  | |
| 𓂋:𓆑 |  | |
| 𓂋:𓊃 |  | |
| 𓂋:𓊪 |       | |
| 𓂋:𓊪° |   | |
| 𓂋:𓍿𓀀𓏪 |                | |
| 𓂋:𓎡 |  | |
| 𓂋:𓎡° |  | |
| 𓂋:𓏏*𓏰 |              | |
| 𓂋:𓏥𓏲 |     | |
| 𓂋:𓐍 |             | |
| 𓂋:𓐍@1 |  | |
| 𓂓𓏤1 | 𓂓𓏤 |  |
| 𓂓𓏤2 | 𓂓𓏤 |   |
| 𓂙:𓈖2 |  | |
| 𓂙:𓈖2:𓏏*𓏰 |  | |
| 𓂚3 | 𓂚 |  |
| 𓂚3𓍘𓇋4 | 𓂚𓍘𓇋 |  |
| 𓂜1 | 𓂜 |   |
| 𓂜1:𓅪 |    | |
| 𓂝 | 𓂝 |             |
| 𓂝:𓂝 |    | |
| 𓂝:𓂝:° |  | |
| 𓂝:𓂝:°𓏤 |  | |
| 𓂝:𓂝𓏤 |     | |
| 𓂝:𓂻 |         | |
| 𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥 |       | |
| 𓂝:𓈖 |   | |
| 𓂝:𓈖:° |  | |
| 𓂝:𓈖𓏌𓏲1 |   | |
| 𓂝:𓈙𓀞2 |    | |
| 𓂞'𓏲 | 𓂞𓏲 |      |
| 𓂞:𓏏2 |          | |
| 𓂞:𓏏3 |                        | |
| 𓂞:𓏏3 𓏞𓍼:𓏤@ |  | |
| 𓂞:𓏏3𓋴𓏏3𓏏 |         | |
| 𓂞:𓏏6 |                    | |
| 𓂞:𓏏6𓏲 |                    | |
| 𓂞𓏲1 | 𓂞𓏲 |  |
| 𓂧 | 𓂧 |      |
| 𓂧':𓏭 |               | |
| 𓂧:𓏏*𓏤 |            | |
| 𓂭:𓎆 |  | |
| 𓂭:𓎈 |  | |
| 𓂭:𓏿 |  | |
| 𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 |    |
| 𓂷:𓂡1 |     | |
| 𓂷:𓂡1:° |  | |
| 𓂸:𓏏 |    | |
| 𓂸:𓏏𓂭𓂭 |    | |
| 𓂺1 | 𓂺 |  |
| 𓂺4 | 𓂺 |  |
| 𓂻 | 𓂻 |                   |
| 𓂻1:° | 𓂻 |  |
| 𓂻:° | 𓂻 |                                          |
| 𓂼 | 𓂼 |   |
| 𓂼1 | 𓂼 |   |
| 𓂼2 | 𓂼 |   |
| 𓂼2𓂼1 | 𓂼𓂼 |   |
| 𓂼𓏲1𓂼 | 𓂼𓏲𓂼 |  |
| 𓂽 | 𓂽 |   |
| 𓂽1 | 𓂽 |      |
| 𓂽:° | 𓂽 |  |
| 𓂾𓂾 | 𓂾𓂾 |    |
| 𓃀 | 𓃀 |   |
| 𓃀3𓏲1 | 𓃀𓏲 |            |
| 𓃀4𓏲4 | 𓃀𓏲 |      |
| 𓃀:𓈖1 |                         | |
| 𓃀:𓈖1:° |         | |
| 𓃀:𓈖1:°𓊪:𓏭2 |  | |
| 𓃀:𓈖1𓊪:𓏭2 |                 | |
| 𓃀𓏲1 | 𓃀𓏲 |                     |
| **𓃀𓏲1𓅃𓅆'**:𓎡1 |  | |
| 𓃂 | 𓃂 |                     |
| 𓃂𓈘:𓈇 | 𓃂 |     |
| 𓃂𓈘:𓈇:° | 𓃂 |               |
| 𓃂𓈘:𓈇° | 𓃂 |   |
| 𓃛 | 𓃛 |     |
| 𓃛𓃛 | 𓃛𓃛 |   |
| 𓃭 | 𓃭 |                                                |
| 𓃭𓏤 | 𓃭𓏤 |                                |
| 𓃹:𓈖 |                         | |
| 𓃹:𓈖2 |            | |
| 𓃹:𓈖𓏌𓏲1 |    | |
| 𓄂:𓏏*𓏤 |                 | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1𓄣𓏤 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤 |   | |
| 𓄋:𓊪1 |   | |
| 𓄋:𓊪@ |        | |
| 𓄋:𓊪@𓏲𓏭:𓏛 |      | |
| 𓄑:𓏛 |  | |
| 𓄑:𓏛1 |                           | |
| 𓄑:𓏛@ |   | |
| 𓄕 | 𓄕 |   |
| 𓄕𓅓𓏭:𓏛 | 𓄕𓅓 |   |
| 𓄖:𓂻 |       | |
| 𓄛1 | 𓄛 |        |
| 𓄛2 | 𓄛 |   |
| 𓄞:𓂧 |  | |
| 𓄟1 | 𓄟 |   |
| 𓄡:𓏏*𓏤 |     | |
| 𓄡:𓏏*𓏤@ |     | |
| 𓄣1𓏤1 | 𓄣𓏤 |  |
| 𓄣𓏤 | 𓄣𓏤 |        |
| 𓄤 | 𓄤 |         |
| 𓄤𓏭:𓏛 | 𓄤 |        |
| 𓄧 | 𓄧 |   |
| 𓄹:𓏭 |                                                | |
| 𓄹:𓏭1 |  | |
| 𓄿 | 𓄿 |        |
| 𓄿1 | 𓄿 |                                                                               |
| 𓄿3 | 𓄿 |  |
| 𓄿:° | 𓄿 |          |
| 𓄿:°𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓄿𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓅃𓅆 | 𓅃𓅆 |      |
| 𓅆 | 𓅆 |                                                                                                                                     |
| 𓅆@ | 𓅆 |            |
| 𓅆@° | 𓅆 |   |
| 𓅆° | 𓅆 |      |
| 𓅐 | 𓅐 |      |
| 𓅐𓏏:𓆇 | 𓅐 |    |
| 𓅐𓏲2𓏏:𓆇 | 𓅐𓏲 |  |
| 𓅓 | 𓅓 |                                                          |
| 𓅓'𓎔 | 𓅓𓎔 |  |
| 𓅓1 | 𓅓 |                                                                                                  |
| 𓅓1𓄛2 | 𓅓𓄛 |  |
| 𓅓1𓄿1 | 𓅓𓄿 |  |
| 𓅓1𓅐𓏏:𓆇 | 𓅓𓅐 |  |
| 𓅓1𓈖:𓏥 | 𓅓 |   |
| 𓅓1𓍱𓏤1 | 𓅓𓍱𓏤 |  |
| 𓅓1𓏲𓏭:𓏛 | 𓅓𓏲 |  |
| 𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓅓𓐠𓏤 |                             |
| 𓅓:𓏏 |   | |
| 𓅓:𓏏𓀐 |   | |
| 𓅓𓁹 | 𓅓𓁹 |     |
| 𓅓𓂺:𓏤 | 𓅓 |   |
| 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 | 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 |  |
| 𓅓𓎔 | 𓅓𓎔 |         |
| 𓅓𓏭 | 𓅓𓏭 |    |
| 𓅓𓏭:𓏛 | 𓅓 |       |
| 𓅓𓏭:𓏛@ | 𓅓 |       |
| 𓅘 | 𓅘 |   |
| 𓅝:𓏏*𓏭 |   | |
| 𓅝:𓏏*𓏭𓅆 |   | |
| 𓅠 | 𓅠 |       |
| 𓅠𓏭:𓏛 | 𓅠 |       |
| 𓅡◳𓏤 |                                  | |
| 𓅨:𓂋*𓏰 |         | |
| 𓅪 | 𓅪 |         |
| 𓅪:° | 𓅪 |      |
| 𓅬 | 𓅬 |   |
| 𓅬3 | 𓅬 |   |
| 𓅬◳𓀀 |  | |
| 𓅯𓄿 | 𓅯𓄿 |                                                                                                                                                                                                |
| 𓅯𓄿3 | 𓅯𓄿 |  |
| 𓅯𓄿𓂞𓏲1 | 𓅯𓄿𓂞𓏲 |  |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋 | 𓅯𓄿𓇋𓇋 |     |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓅯𓄿𓇋𓇋 |     |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 | 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 |                                   |
| 𓅯𓄿𓇋𓏲𓆑 | 𓅯𓄿𓇋𓏲𓆑 |  |
| 𓅯𓄿𓏭1 | 𓅯𓄿𓏭 |                                          |
| 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 | 𓅯𓄿𓏲 |    |
| 𓅱 | 𓅱 |            |
| 𓅱𓃀4𓏲4 | 𓅱𓃀𓏲 |      |
| 𓅱𓄋:𓊪@ | 𓅱 |  |
| 𓆄 | 𓆄 |     |
| 𓆇:𓏤 |    | |
| 𓆈:𓏥 |      | |
| 𓆊 | 𓆊 |        |
| 𓆎 | 𓆎 |  |
| 𓆎@2 | 𓆎 |                         |
| 𓆎@2𓅓1 | 𓆎𓅓 |                   |
| 𓆎@2𓅓𓏭:𓏛 | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆎@2𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |      |
| 𓆎𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆑 | 𓆑 |                                                                                                                                                                |
| 𓆑1 | 𓆑 |          |
| 𓆑1𓅆 | 𓆑𓅆 |        |
| 𓆑4 | 𓆑 |     |
| 𓆑:𓏭 |      | |
| 𓆓:𓂧 |                                                                                                                                                       | |
| 𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3 |   | |
| 𓆙 | 𓆙 |             |
| 𓆛:𓈖 |    | |
| 𓆣:𓂋𓏲 |                                                                    | |
| 𓆤1 | 𓆤 |   |
| 𓆤1:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓆮 | 𓆮 |       |
| 𓆰:𓈖𓏪:° |        | |
| 𓆰𓏪 | 𓆰𓏪 |       |
| 𓆰𓏪@1 | 𓆰𓏪 |         |
| 𓆱:𓏏*𓏤 |                               | |
| 𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥:° |      | |
| 𓆱:𓏥:° |      | |
| 𓆳 | 𓆳 |           |
| 𓆳𓏏:𓊗3 | 𓆳 |      |
| 𓆳𓏤𓏰:𓇳5 | 𓆳𓏤 |           |
| 𓆷 | 𓆷 |      |
| 𓆷1 | 𓆷 |        |
| 𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳1 | 𓆷𓏰𓏰 |     |
| 𓆸 | 𓆸 |      |
| 𓆼 | 𓆼 |               |
| 𓆼1 | 𓆼 |         |
| 𓆼𓄿3 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿3𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿5 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿5𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |        |
| 𓆼𓄿𓂝:𓂻1 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓇁 | 𓇁 |   |
| 𓇇 | 𓇇 |  |
| 𓇋 | 𓇋 |  |
| 𓇋1 | 𓇋 |                    |
| 𓇋1𓇋𓀀 | 𓇋𓇋𓀀 |    |
| 𓇋1𓏏:𓆑 | 𓇋 |    |
| 𓇋2 | 𓇋 |              |
| 𓇋2𓂋:𓊪 | 𓇋 |           |
| 𓇋2𓆛:𓈖 | 𓇋 |    |
| 𓇋2𓊪1 | 𓇋𓊪 |   |
| 𓇋5 | 𓇋 |           |
| 𓇋5:𓎡 |           | |
| 𓇋𓀁 | 𓇋𓀁 |              |
| 𓇋𓀁1 | 𓇋𓀁 |                                         |
| 𓇋𓀁1𓋴𓏏 | 𓇋𓀁𓋴𓏏 |   |
| 𓇋𓀁𓂋:𓎡 | 𓇋𓀁 |  |
| 𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤 | 𓇋𓀁 |            |
| 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛 | 𓇋𓀁𓏤 |          |
| 𓇋𓂋:𓏭 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓂋:𓏭𓀹1 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓇋 | 𓇋𓇋 |                 |
| 𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓇋𓇋 |          |
| 𓇋𓇋𓆑 | 𓇋𓇋𓆑 |    |
| 𓇋𓇋𓏲 | 𓇋𓇋𓏲 |                                                                                                                                                                        |
| 𓇋𓈖 | 𓇋𓈖 |           |
| 𓇋𓋴𓏏 | 𓇋𓋴𓏏 |                           |
| 𓇋𓎛𓃒 | 𓇋𓎛𓃒 |      |
| 𓇋𓏠:𓈖 | 𓇋 |     |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆 | 𓇋 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆° | 𓇋 |  |
| 𓇋𓏲 | 𓇋𓏲 |                                                                                                                                                    |
| 𓇋𓏲 𓏪3 | 𓇋𓏲 𓏪 |  |
| 𓇋𓏲1 | 𓇋𓏲 |  |
| 𓇋𓏲𓆑 | 𓇋𓏲𓆑 |                               |
| 𓇋𓏲𓏪 | 𓇋𓏲𓏪 |   |
| 𓇍1𓇋1 | 𓇍𓇋 |             |
| 𓇍1𓇋1𓂻 | 𓇍𓇋𓂻 |             |
| 𓇏:° | 𓇏 |  |
| 𓇓1 | 𓇓 |                   |
| 𓇓1𓅆 | 𓇓𓅆 |          |
| 𓇔3 | 𓇔 |  |
| 𓇔3𓏤𓏰:𓊖1 | 𓇔𓏤 |  |
| 𓇘 | 𓇘 |   |
| 𓇘:𓏏*𓏰𓅓 |   | |
| 𓇛1 | 𓇛 |   |
| 𓇣𓂧:𓏏*𓏰𓌽:𓏥1 | 𓇣 |   |
| 𓇥:𓂋1 |       | |
| 𓇥:𓂋1𓏭:𓏛 |   | |
| 𓇥:𓂋1𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2 |   | |
| 𓇥:𓂋2𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇯 | 𓇯 |                                                 |
| 𓇳 | 𓇳 |                            |
| 𓇳𓅆 | 𓇳𓅆 |      |
| 𓇳𓍼:𓏤 | 𓇳 |     |
| 𓇳𓍼:𓏤° | 𓇳 |  |
| 𓇳𓏤 | 𓇳𓏤 |    |
| 𓇹 | 𓇹 |   |
| 𓇹:𓇼 |   | |
| 𓇹:𓇼:𓇳 |   | |
| 𓇺:𓏺 |  | |
| 𓇺:𓏺1 |  | |
| 𓇺:𓏻1 |     | |
| 𓇺:𓏼@ |        | |
| 𓇺:𓏽@ |   | |
| 𓇾:𓏤@ |        | |
| 𓇾:𓏤𓈇@ |   | |
| 𓈉2 | 𓈉 |        |
| 𓈉2:𓏏*𓏤 |        | |
| 𓈌 | 𓈌 |   |
| 𓈌:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓈍:𓂝*𓏛 |      | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆 |    | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆° |  | |
| 𓈎 | 𓈎 |                    |
| 𓈎:° | 𓈎 |  |
| 𓈎:𓈖 |     | |
| 𓈎:𓈖@ |    | |
| 𓈎:𓈖@𓏌𓏲1 |  | |
| 𓈎:𓈖𓏌𓏲1 |   | |
| 𓈐':𓏏*𓏤 |      | |
| 𓈐:𓂻 |     | |
| 𓈐:𓂻@ |   | |
| 𓈒 | 𓈒 |  |
| 𓈒:𓏥 |  | |
| 𓈒:𓏥1 |    | |
| 𓈒:𓏥2 |   | |
| 𓈔 | 𓈔 |   |
| 𓈖 | 𓈖 |                                                                           |
| 𓈖1 | 𓈖 |                     |
| 𓈖1:**𓄿1'𓇋𓇋𓏲** |   | |
| 𓈖1:**𓇛1𓅓1** |   | |
| 𓈖2 | 𓈖 |                                                        |
| 𓈖2:𓄿1𓇋𓇋 |   | |
| 𓈖2:𓌳° |  | |
| 𓈖:𓀀° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖 |                | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁 |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁 |               | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁° |  | |
| 𓈖:𓄿 |                                                                                                                                    | |
| 𓈖:𓄿° |                                | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |  | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑 |  | |
| 𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4 |          | |
| 𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥 |     | |
| 𓈖:𓈖9 |   | |
| 𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 |       | |
| 𓈖:𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖:𓊃 |  | |
| 𓈖:𓊃𓋴𓏏 |  | |
| 𓈖:**𓋴𓆰:𓈖𓏪:°** |        | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲 |           | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1 |        | |
| 𓈖:𓎡2 |  | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 |        | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 |    | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏲𓏭:𓏛 |     | |
| 𓈖:𓏌*𓏲 |                   | |
| 𓈖:𓏌*𓏲1 |  | |
| 𓈖:𓏏 |  | |
| 𓈖:𓏏*𓏭1 |                                                                                             | |
| 𓈖:𓏥 |       | |
| 𓈖:𓏥:° |   | |
| 𓈖:𓏲*𓏥 |                 | |
| 𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 | 𓈖𓇋𓅓 |                                  |
| 𓈗 | 𓈗 |            |
| 𓈗𓈘:𓈇 | 𓈗 |            |
| 𓈘:𓈇 |                 | |
| 𓈘:𓈇:° |               | |
| 𓈘:𓈇° |   | |
| 𓈙 | 𓈙 |                     |
| 𓈝 | 𓈝 |                      |
| 𓈝𓂻:° | 𓈝𓂻 |                      |
| 𓉐2 | 𓉐 |         |
| 𓉐:𓉻 |                                                | |
| 𓉐:𓉻𓅆 |                                                | |
| 𓉐𓏤 | 𓉐𓏤 |                                             |
| 𓉐𓏤1 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@1 | 𓉐𓏤 |                                        |
| 𓉐𓏤@1𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@2 | 𓉐𓏤 |    |
| 𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |            |
| 𓉔 | 𓉔 |                                           |
| 𓉔1 | 𓉔 |       |
| 𓉗1 | 𓉗 |                          |
| 𓉗1:𓉐2 |   | |
| 𓉗1:𓉐𓏤 |  | |
| 𓉗1𓉐𓏤@1 | 𓉗𓉐𓏤 |                 |
| 𓉞 | 𓉞 |   |
| 𓉺1 | 𓉺 |  |
| 𓉺1:𓏏*𓏰𓏌 |  | |
| 𓉻 | 𓉻 |       |
| 𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 |        | |
| 𓉻:𓂝*𓏛 |                                                                | |
| 𓉿:𓂡1 |            | |
| 𓊃 | 𓊃 |         |
| 𓊃4 | 𓊃 |   |
| 𓊃:𓀀:𓈖 |   | |
| 𓊃:𓀀:𓈖𓅓𓏏:𓎡 |   | |
| 𓊃:𓈞𓁐2 |    | |
| 𓊌1 | 𓊌 |         |
| 𓊏 | 𓊏 |        |
| 𓊏𓏭:𓏛 | 𓊏 |        |
| 𓊑1 | 𓊑 |     |
| 𓊖 | 𓊖 |  |
| 𓊗:𓏻1 |   | |
| 𓊡 | 𓊡 |        |
| 𓊡𓏭:𓏛 | 𓊡 |  |
| 𓊡𓏲𓏭:𓏛 | 𓊡𓏲 |       |
| 𓊢𓂝:𓂻 | 𓊢 |     |
| 𓊤 | 𓊤 |   |
| 𓊤𓏲 | 𓊤𓏲 |   |
| 𓊨 | 𓊨 |    |
| 𓊨2 | 𓊨 |  |
| 𓊨2𓏏:𓆇1 | 𓊨 |  |
| 𓊨:° | 𓊨 |   |
| 𓊨:°𓏤𓉐𓏤 | 𓊨𓏤𓉐𓏤 |  |
| 𓊨𓏏:𓆇1 | 𓊨 |    |
| 𓊪 | 𓊪 |          |
| 𓊪1 | 𓊪 |                       |
| 𓊪1:° | 𓊪 |     |
| 𓊪1:𓉐𓏤1 |   | |
| 𓊪:° | 𓊪 |    |
| 𓊪:𓏏𓎛 |    | |
| 𓊪:𓏏𓎛𓅆 |    | |
| 𓊪:𓏭 |       | |
| 𓊪:𓏭2 |                  | |
| 𓊮 | 𓊮 |     |
| 𓊵:𓏏@1 |  | |
| 𓊹 | 𓊹 |            |
| 𓊹𓅆 | 𓊹𓅆 |    |
| 𓊹𓅆° | 𓊹𓅆 |   |
| 𓊹𓊹𓊹 | 𓊹𓊹𓊹 |       |
| 𓊹𓊹𓊹1 | 𓊹𓊹𓊹 |      |
| 𓊹𓍛𓏤:𓀀 | 𓊹𓍛 |     |
| 𓊽 | 𓊽 |   |
| 𓊽1 | 𓊽 |   |
| 𓊽1𓊽1 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓊽𓊽 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓋀 | 𓋀 |     |
| 𓋀𓏤 | 𓋀𓏤 |    |
| 𓋀𓏤𓏰:𓊖3 | 𓋀𓏤 |  |
| 𓋁𓃀1 | 𓋁𓃀 |  |
| 𓋁𓃀1𓏤𓊖 | 𓋁𓃀𓏤𓊖 |  |
| 𓋋:𓏏*𓆇 |  | |
| 𓋞:𓈒*𓏥1 |   | |
| 𓋩1 | 𓋩 |   |
| 𓋩2 | 𓋩 |  |
| 𓋴 | 𓋴 |                                                               |
| 𓋴@𓏤 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴@𓏤𓄹:𓏭 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴𓀀 | 𓋴𓀀 |  |
| 𓋴𓇋1𓅨:𓂋*𓏰 | 𓋴𓇋 |      |
| 𓋴𓏏 | 𓋴𓏏 |                                                                                  |
| 𓋴𓏏1𓏏 | 𓋴𓏏𓏏 |   |
| 𓋴𓏏@ | 𓋴𓏏 |    |
| 𓋹𓈖:𓐍 | 𓋹 |          |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |          |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏2 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |                                                      |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏4 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |           |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰 | 𓌃 |             |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁 | 𓌃 |         |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁° | 𓌃 |     |
| 𓌉 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥 | 𓌉 |   |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥1 | 𓌉 |     |
| 𓌗1 | 𓌗 |     |
| 𓌗2 | 𓌗 |  |
| 𓌙 | 𓌙 |   |
| 𓌙:𓈉 |                   | |
| 𓌙:𓈉1 |             | |
| 𓌙𓅓1 | 𓌙𓅓 |   |
| 𓌞:𓊃 |   | |
| 𓌞:𓊃1 |   | |
| 𓌞:𓊃1𓂻:° |   | |
| 𓌞:𓊃𓇋𓏲𓂻 |   | |
| 𓌡:𓂝*𓏤3 |           | |
| 𓌢° | 𓌢 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌨:𓂋𓏭:𓏛 |      | |
| 𓌪:𓂡 |      | |
| 𓌳° | 𓌳 |  |
| 𓌶:𓂝2 |     | |
| 𓌶:𓂝2𓆄 |     | |
| 𓌻 | 𓌻 |          |
| 𓌻𓀁 | 𓌻𓀁 |   |
| 𓌻𓏭:𓏛1𓀁 | 𓌻 |        |
| 𓌽:𓏥𓏤 |  | |
| 𓍃 | 𓍃 |     |
| 𓍃𓅓𓏭:𓏛 | 𓍃𓅓 |    |
| 𓍃𓏭:𓏛 | 𓍃 |  |
| 𓍊𓏤 | 𓍊𓏤 |     |
| 𓍑 | 𓍑 |                      |
| 𓍑𓄿3 | 𓍑𓄿 |             |
| 𓍑𓍑 | 𓍑𓍑 |     |
| 𓍓1 | 𓍓 |  |
| 𓍓1𓄿3 | 𓍓𓄿 |  |
| 𓍘 | 𓍘 |  |
| 𓍘1 | 𓍘 |                  |
| 𓍘1𓎟:𓏏1 | 𓍘 |        |
| 𓍘𓇋2 | 𓍘𓇋 |    |
| 𓍘𓇋4 | 𓍘𓇋 |       |
| 𓍘𓈖:𓏏 | 𓍘 |  |
| 𓍘𓈖:𓏏1 | 𓍘 |  |
| 𓍣 | 𓍣 |  |
| 𓍦 | 𓍦 |  |
| 𓍩 | 𓍩 |  |
| 𓍬:𓂻 |   | |
| 𓍬:𓂻':° |  | |
| 𓍯 | 𓍯 |                                      |
| 𓍱 | 𓍱 |       |
| 𓍱1 | 𓍱 |  |
| 𓍱:𓂡1 |    | |
| 𓍱:𓂡1𓏏 |    | |
| 𓍱@𓏤 | 𓍱𓏤 |   |
| 𓍱@𓏤𓏛:𓏫:° | 𓍱𓏤 |   |
| 𓍱𓏤1𓏛:𓏫:° | 𓍱𓏤 |   |
| 𓍱𓏤𓏛:𓏫:° | 𓍱𓏤 |  |
| 𓍴 | 𓍴 |       |
| 𓍴1 | 𓍴 |  |
| 𓍴1𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖9 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |       |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2 | 𓍴 |    |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓋩2 | 𓍴 |  |
| 𓍸𓏛1 | 𓍸𓏛 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |                                                                     |
| 𓍺 | 𓍺 |                              |
| 𓍼:𓏤1 |   | |
| 𓍼:𓏥 |  | |
| 𓎃° | 𓎃 |    |
| 𓎆 | 𓎆 |              |
| 𓎇 | 𓎇 |  |
| 𓎈 | 𓎈 |  |
| 𓎉 | 𓎉 |   |
| 𓎔 | 𓎔 |  |
| 𓎔2 | 𓎔 |                |
| 𓎔2: | 𓎔: |          |
| 𓎔:𓏏*𓏏 |  | |
| 𓎔:𓏏*𓏏𓏤𓊖 |  | |
| 𓎔:𓏺 |   | |
| 𓎔:𓏻 |      | |
| 𓎔:𓏼 |      | |
| 𓎔:𓏽 |    | |
| 𓎛 | 𓎛 |        |
| 𓎛1 | 𓎛 |  |
| 𓎛2 | 𓎛 |         |
| 𓎛2𓐑:𓊪1𓅆 | 𓎛 |  |
| 𓎛2𓐑:𓊪𓏲1 | 𓎛 |        |
| 𓎛𓂝:𓏏𓄹 | 𓎛 |   |
| 𓎛𓈖:𓂝 | 𓎛 |  |
| 𓎝𓎛 | 𓎝𓎛 |   |
| 𓎝𓎛𓏰:𓏛 | 𓎝𓎛 |  |
| 𓎟:𓏏 |        | |
| 𓎟:𓏏1 |       | |
| 𓎡 | 𓎡 |                             |
| 𓎡1 | 𓎡 |             |
| 𓎡1:𓇋1𓇋𓀀 |    | |
| 𓎡:𓍘𓇋 |    | |
| 𓎨 | 𓎨 |           |
| 𓎭 | 𓎭 |    |
| 𓎱1 | 𓎱 |      |
| 𓎱1:𓇳 |    | |
| 𓎱1:𓏰:𓇳1 |   | |
| 𓎸 | 𓎸 |   |
| 𓎸1 | 𓎸 |  |
| 𓎸𓅓𓏰:𓇳1 | 𓎸𓅓 |   |
| 𓎼 | 𓎼 |                        |
| 𓏇1 | 𓏇 |   |
| 𓏇1𓇋1 | 𓏇𓇋 |   |
| 𓏌 | 𓏌 |               |
| 𓏌:𓈖 |         | |
| 𓏌:𓈖:° |     | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤 |    | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤@1 |  | |
| 𓏌:𓈖𓏤1𓉐𓏤@1 |    | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤 |   | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤@1 |    | |
| 𓏌:𓏤 |  | |
| 𓏌𓏲1 | 𓏌𓏲 |                  |
| 𓏌𓏲2 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏌𓏲𓍖:𓏛 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏎:𓈖 |          | |
| 𓏎:𓈖:° |  | |
| 𓏎:𓈖𓏤 |      | |
| 𓏏 | 𓏏 |                                                                                                |
| 𓏏*𓏤 | 𓏏𓏤 |        |
| 𓏏*𓏰 | 𓏏𓏰 |         |
| 𓏏1 | 𓏏 |                          |
| 𓏏1:° | 𓏏 |  |
| 𓏏:° | 𓏏 |   |
| 𓏏:𓄿 |                                                                                | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |     | |
| 𓏏:𓄿𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑 |      | |
| 𓏏:𓄿𓏭 |           | |
| 𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥 |  | |
| 𓏏:𓆇 |         | |
| 𓏏:𓆇1 |    | |
| 𓏏:𓆑 |    | |
| 𓏏:𓈇𓏤@1 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥 |   | |
| 𓏏:𓈖:𓏥:° |    | |
| 𓏏:𓈙 |   | |
| 𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖1 |  | |
| 𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖3 |  | |
| 𓏛 | 𓏛 |    |
| 𓏛:𓏫:° |     | |
| 𓏛𓏏 | 𓏛𓏏 |  |
| 𓏞𓍼:𓏤 | 𓏞 |    |
| 𓏞𓍼:𓏤@ | 𓏞 |         |
| 𓏠:𓈖 |           | |
| 𓏠:𓈖1 |   | |
| 𓏠:𓈖1:° |   | |
| 𓏠:𓈖1:°𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |   | |
| 𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛 |  | |
| 𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |  | |
| 𓏠:𓈖𓐍:𓍊𓏤 |  | |
| 𓏤 | 𓏤 |                                                  |
| 𓏤1 | 𓏤 |     |
| 𓏤1𓈘:𓈇 | 𓏤 |  |
| 𓏤𓊖 | 𓏤𓊖 |    |
| 𓏤𓏛:𓏫:° | 𓏤 |  |
| 𓏤𓏰:𓇳5 | 𓏤 |           |
| 𓏤𓏰:𓊖1 | 𓏤 |        |
| 𓏤𓏰:𓊖3 | 𓏤 |                       |
| 𓏥 | 𓏥 |       |
| 𓏪 | 𓏪 |                                                                                                                                                                 |
| 𓏪1 | 𓏪 |                                                                             |
| 𓏪1° | 𓏪 |    |
| 𓏪3 | 𓏪 |                                       |
| 𓏫 | 𓏫 |      |
| 𓏫1:° | 𓏫 |   |
| 𓏫:° | 𓏫 |     |
| 𓏭:𓂢 |     | |
| 𓏭:𓏛 |                                                    | |
| 𓏭:𓏛1 |                               | |
| 𓏰:𓀀 |   | |
| 𓏰:𓇳1 |                    | |
| 𓏰:𓇳1@ |           | |
| 𓏰:𓇳2𓏤2 |           | |
| 𓏰:𓊖2° |    | |
| 𓏰:𓏛 |  | |
| 𓏲 | 𓏲 |                      |
| 𓏲1 | 𓏲 |        |
| 𓏲2 | 𓏲 |   |
| 𓏲:𓏏 |                            | |
| 𓏲:𓏏𓏤 |         | |
| 𓏲𓏭:𓏛 | 𓏲 |                                                           |
| 𓏴:𓂡 |             | |
| 𓏴:𓂡𓍘1 |         | |
| 𓏴:𓏛4 |   | |
| 𓏴:𓏛4𓀁 |   | |
| 𓏶 | 𓏶 |      |
| 𓏶𓅓 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓1 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓𓏭 | 𓏶𓅓𓏭 |    |
| 𓏺 | 𓏺 |      |
| 𓏺:𓏏 |      | |
| 𓏻 | 𓏻 |   |
| 𓏻4 | 𓏻 |  |
| 𓏻:𓏌 |   | |
| 𓏼1 | 𓏼 |              |
| 𓏽1 | 𓏽 |   |
| 𓏾 | 𓏾 |      |
| 𓏾2 | 𓏾 |  |
| 𓏿 | 𓏿 |        |
| 𓐀 | 𓐀 |       |
| 𓐀1 | 𓐀 |  |
| 𓐁 | 𓐁 |     |
| 𓐁1 | 𓐁 |   |
| 𓐁1:𓐋2𓏌𓏲1𓀼 |   | |
| 𓐁:° | 𓐁 |  |
| 𓐂 | 𓐂 |    |
| 𓐅 | 𓐅 |  |
| 𓐆 | 𓐆 |  |
| 𓐇 | 𓐇 |  |
| 𓐈1 | 𓐈 |  |
| 𓐉 | 𓐉 |  |
| 𓐊 | 𓐊 |   |
| 𓐋2 | 𓐋 |   |
| 𓐍 | 𓐍 |                 |
| 𓐍:𓂋 |      | |
| 𓐍:𓂋𓀁 |      | |
| 𓐍:𓅓 |     | |
| 𓐍:𓅓𓅪 |  | |
| 𓐍:𓅓𓅪:° |    | |
| 𓐍:𓊪2 |   | |
| 𓐍:𓏏*𓏰 |    | |
| 𓐍:𓏭 |            | |
| 𓐑:𓊪 |       | |
| 𓐑:𓊪1 |  | |
| 𓐑:𓊪𓏲1 |  | |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛 | 𓐠𓏤 |                |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓐠𓏤 |                            |
| 𓐪 | 𓐪 |    |
| 𓐪𓂧:𓏏*𓏰 | 𓐪 |   |
| 𓐪𓏏:𓊌 | 𓐪 |  |
| | |  |
| | |         |
| ⸗y "[Suffixpron. 1. sg. c.]" |               |
| ⸗w; [⸗w]; ⸢⸗w⸣; [[⸗w]] "[Suffixpron. 3. pl. c.]" |                                                                                                                                                |
| ⸗f; [⸗f]; ⸢⸗f⸣ "[Suffixpron. 3. sg. m.]" |                                                                                                                                                           |
| ⸗n "[Suffixpron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸗s; ⸢⸗s⸣; {⸗s} "[Suffixpron. 3. sg. f.]" |                                               |
| ⸗k "[Suffixpron. 2. sg. m.]" | 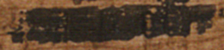       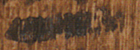 |
| ⸗tn "[Suffixpron. 2. pl. c.]" |     |
| ꜣwy "Lobpreis" |  |
| ꜣbḫ "vergessen" |  |
| ꜣbd "Monat" |   |
| ꜣbd-1 "Monat 1" |   |
| ꜣbd-2 "Monat 2" |     |
| ꜣbd-3; ⸢ꜣbd-3⸣ "Monat 3" |        |
| ꜣbd-4 "Monat 4" |   |
| ꜣbdy "Neulicht, zweiter Tag des Mondmonats" |   |
| ꜣfꜥ(.t); ꜣfꜥ(.w) "gierig [Adjektiv]" |   |
| ꜣrwy "Stengel, Stoppel, Spreu" |   |
| ꜣlly "Weinstock, Rebe" |  |
| ꜣḥ.w "Acker" |  |
| ꜣḫ(.t) "Überschwemmungsjahreszeit, Achet" |     |
| ꜣs(.t) "Isis [GN]" |   |
| ⸢ꜣsy⸣ "leicht sein" |  |
| ꜣsḳ "zögern" | 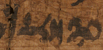 |
| ꜣgy "tüchtig, vorzüglich, vortrefflich" | 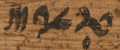 |
| ꜣḏꜣ(.t) "Hacke" | 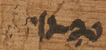 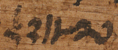 |
| ỉ "o" |  |
| ỉ.ỉr-ḥr; ỉ:ỉr-ḥr "vor, bei, zur Zeit von [Präp.]" |     |
| ỉ.ḳd "Baumeister" |  |
| ỉꜣw.t "Amt, Würde" |    |
| ỉꜣw.t-(n)-ḥrỉ "Herrscheramt" |    |
| ỉꜣb.tỉ "Osten" |  |
| ỉ:ỉri̯ "[Konverter 2. Tempus]" |      |
| ỉ:ỉri̯; (ỉ:)ỉri̯; ⸢ỉ:ỉri̯⸣ "[Bildungselement des Partizips]" |                 |
| ỉ:ỉri̯⸗f "[Konverter 2. Tempus + Suffixpron. 3. sg. m.]" | 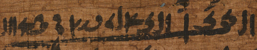   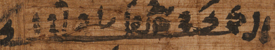      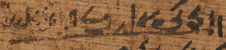 |
| ỉyi̯ "kommen" |            |
| ỉꜥḥ "Mond" |  |
| Ỉꜥḥ-ms; 𓍹Ỉꜥḥ-ms; 𓍹Ỉꜥḥ-ms ꜥ.w.s; Ỉꜥḥ-ms ꜥ.w.s "Amasis [KN]" |        |
| ỉw; [ỉw] "[Bildungselement des Futur III]" |                                                            |
| ⸢ỉw⸗w⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. pl. c.]" |   |
| ỉw⸗f "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗f "wenn er [Konditionalis + Suffixpron. 3. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗f; ⸢ỉw⸗f⸣ "er [proklit. Pron. 3. sg. m.]" |        |
| ỉw⸗f; ỉw⸗f(?) "indem er [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |             |
| ỉw⸗s "sie [proklit. Pron. 3. sg. f.]" |       |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. f.]" |       |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣; ⸢ỉw⸣⸗s "indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. f.]" |             |
| ỉw⸗k "du [proklit. Pron. 2. sg. m.]" |   |
| ỉw⸗k "indem du [Umstandskonverter + Suffixpron. 2. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗k "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 2. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗k "[Konditionalis + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉwi̯; ỉwi̯.w "kommen" |    |
| ỉwỉw.w; ỉwỉw "Hund" |   |
| ỉwn "Schiffsfahrt " |  |
| Ỉwnw "Heliopolis [ON])" | 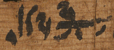 |
| ỉwr "schwanger werden" |  |
| ỉb "Herz" |  |
| ỉbỉ "Honig" |   |
| ỉp "zählen" |     |
| ỉpe.t; ỉpe(.t); ỉp(.t) "Arbeit" |         |
| ỉpre "Sproß, Samen, Korn" |  |
| ỉpt "Tafel" |  |
| ỉpd.w; ỉpd; ỉpd(.w) "Geflügel, Gans, Vogel" |    |
| ỉmn "Amun [GN]" |   |
| ỉmn.tỉ "Westen" |  |
| Ỉmn-ỉ:ỉri̯-ḏi̯.t-s "Amyrtaios [KN]" | 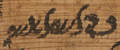  |
| ỉn "[Fragepartikel]" |     |
| ỉn; ⸢ỉn⸣ "[Postnegation]" |      |
| ỉn.ḳdy "schlafen" |  |
| ỉn-nꜣ.w "wenn [Bildungselement Konditionalis]" |  |
| ỉni̯ "holen, bringen" |        |
| ỉne "Stein" |    |
| ỉr.t "Auge" |   |
| ỉrỉ "Gefährte" |  |
| ỉri̯; {ỉri̯}; ỉri̯ (?); ỉ:ỉri̯; ⸢ỉri̯⸣ "tun, machen" |                                                          |
| ỉri̯⸗f "[Verb + Suffixpron. 3. sg. masc.]" |      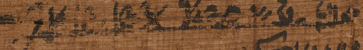    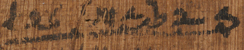 |
| ỉri̯-ỉp(.t) "Geschäft" |  |
| ỉri̯-ḥrỉ "Herrschaft, Regierung" |        |
| ỉri̯-sh̭y "Macht haben über, verfügen über" |  |
| ỉrp "Wein" |   |
| ỉrpy; ỉrp⸢y⸣.w; ỉrpy.w; ỉrpꜣ; ỉrpꜣ.w; ⸢ỉrpꜣ⸣.w; ỉrpꜣ(.w); ⸢ỉrp⸣ "Tempel" |                 |
| ỉrm; ⸢ỉrm⸣ "mit, und [Präp.]" |          |
| ỉrm pꜣ ḫpr ꜥn "und ferner" | 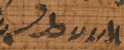 |
| ỉḥ.w "Rind" |   |
| ỉḥ.t "Kuh" |  |
| ỉḫ "was?, wer?" |  |
| ỉšr "Syrer, Assyrer" |  |
| ỉṱ "Vater" |    |
| ỉt "Gerste" |  |
| yꜥbꜣ(.t); yꜥb⸢ꜣ(.t)⸣ "Krankheit" |    |
| yꜥr "Fluß, Kanal" | 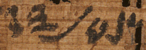  |
| yꜥr-ꜥꜣ "'großer Fluß', Nil" | 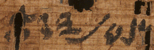 |
| Ybyꜣ "Elephantine [ON]" | 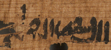 |
| ys "eilen" |  |
| [ꜥ].wỉ; ꜥwỉ.w; ꜥ.wỉ "Haus, Platz" |      |
| ꜥ.wỉ-(n)-wpy "Haus des Richtens, Gericht" |  |
| ꜥꜣ "Art, Zustand" |    |
| ꜥꜣ; ꜥy.w; ⸢ꜥy.w⸣; ⸢ꜥꜣ⸣ "groß [Adjektiv]" |           |
| ⸢ꜥy.w-(n)-ms⸣ "alt sein, alt werden" |  |
| ꜥw; ꜥꜣ; ꜥy "groß sein [Adjektivverb]" |     |
| ꜥw-n-ỉr.t "Glück" |  |
| ꜥby.t "Spende, Opfer" | 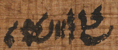 |
| ꜥn; ⸢ꜥn⸣ "erneut, wieder [Adverb]" |         |
| ꜥnḫ "leben" |     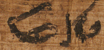  |
| ꜥnḫ "Leben" |  |
| ꜥnḫ.t "Anches [PN]" |  |
| ꜥrꜥy(.t); ꜥry(.t) "Uräusschlange" |        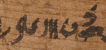 |
| ꜥrwy "vielleicht [Adv.]" | 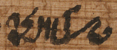 |
| ꜥrḳy "letzter Monatstag" |      |
| ꜥrḏ "Sicherheit, Festigkeit" |  |
| ꜥḥꜥ "stehen" |     |
| ꜥḫ "Feuerbecken, Ofen" |    |
| ꜥš "rufen" |    |
| ꜥš-šlly "flehen" |  |
| ꜥšꜣ "zahlreich sein [Adjektivverb]" |     |
| ꜥšꜣ "zahlreich [Adjektiv]" |  |
| ꜥḳ "Brot, Ration" |     |
| wꜣḥ "Antwort" |  |
| wꜣḥ-sḥn "befehlen" |  |
| wyꜥ "Bauer" | 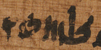 |
| Wynn.w; Wynn(.w) "Grieche" |   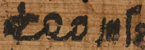 |
| wꜥ.t; wꜥ; ⸢wꜥ⸣ "eine" |                |
| wꜥb "Reinheit; Reinigung" |  |
| wꜥb; wꜥb.w "Priester" |          |
| wꜥb.w; wꜥb "rein sein, unbelastet sein" |          |
| wꜥb.t "Balsamierung, Tod" |  |
| wbꜣ "gegenüber [Präp.]" |  |
| wpy "öffnen, trennen, richten" |  |
| wn "öffnen" |            |
| wn "sein, existieren" |       |
| Wn-h̭m "Wenchem [ON]" |  |
| wnm "rechts, rechte Seite" |    |
| wnm "essen" |      |
| wnty.w "Kurzhornrind, Opfertier " |  |
| wr<š>e "Altlicht; Mondmonat" |   |
| whꜥ "böse Tat, Sünde, Verfehlung" |  |
| Wsr⸢kn⸣(?) "Osorkon [PN]" |  |
| wṱ "Befehl, Erlass, Dekret" |  |
| wḏꜣ "unversehrt sein" |  |
| b⸢ꜣ⸣(.t) "Busch" |  |
| bỉk.w "Falke" |  |
| bw-ỉri̯; ⸢bw⸣-ỉri̯ "[Negation des Aorists]" |         |
| bw-ỉri̯-tw "noch nicht [neg. Perfekt]" |  |
| bn "[Negation]" |  |
| bn "böse, schlecht, schlimm [Adjektiv]" |  |
| bn.ỉw "[Negation Futur III]" |     |
| bn.ỉw "[Negation Präsens I]" |     |
| bn-p "[Negation Vergangenheit]" |                  |
| bnr "Außen, Außenseite" |  |
| blꜣ "lösen" |  |
| bš "entblößen, verlassen, reduzieren" |  |
| bgs "sich empören, rebellieren" |  |
| btw "Strafe" | 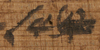    |
| bd(.t) "Emmer" |   |
| p.t; p(.t) "Himmel" |   |
| pꜣ; ⸢pꜣ⸣ "der [def. Art. sg. m.]" |                                                                                                                                                                         |
| pꜣ tꜣ (n) rsỉ "Südland" |  |
| pꜣ tꜣ (n) ẖr "Syrerland, Syrien [ON]" |   |
| pꜣ-bnr-n; pꜣ-bnr-(n) "außer, außerhalb [Präp.]" |   |
| pꜣ-hrw "heute, jetzt [Adverb]" |     |
| Pꜣ-s-n-mṯk(?) "Psammetich [PN]" |  |
| Pꜣ-s-n-[mṯk](?) "Psammetich [KN]" |  |
| Pꜣ-šrỉ-Mw.t "Psammuthis [KN]" |  |
| ⸢Pꜣ⸣-di̯-ꜣs(.t) "Peteesis [PN]" |  |
| pꜣỉ "[def. Art. sg. m. + Präfix der Relativform]" |   |
| pꜣỉ "dieser [Demonstrat. sg. m.]" |  |
| pꜣỉ; ⸢pꜣỉ⸣ "[Kopula sg. m.]" |                                       |
| pꜣy⸗ỉ "mein" |  |
| pꜣy⸗w "ihr" |    |
| pꜣy⸗f; ⸢pꜣy⸗f⸣ "sein" |                                  |
| pꜣy⸗n "unser" |    |
| pꜣy⸗k "dein" |  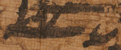   |
| ⸢pa⸣; pa "der von" |       |
| Py "Pe, Buto [ON]" | 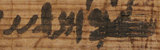  |
| py "Thron" |  |
| pr "der [def. Artikel sg. m., v.a. bei Himmelsrichtungen]" |  |
| pr.w; pr "Haus" |   |
| pr(.t) "Aussaat-Zeit, Peret, Winter" |       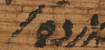     |
| pr-ꜥꜣ; ⸢pr-ꜥꜣ⸣ "König" |             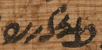                                  |
| pr-pr-ꜥꜣ "Königspalast" |  |
| Pr-nb(.t)-ṱp-ỉḥ "Aphroditopolis, Atfih [ON]" | 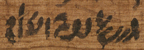 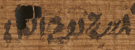 |
| pri̯ "herauskommen" |  |
| prt.w; prt "Saatgut, Getreide" |   |
| prḏꜣ "Kinn(?)" | 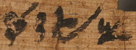 |
| pḥ "erreichen, ankommen" |       |
| pẖrꜣ "herumgehen, durchziehen" | 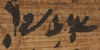 |
| pẖry.w(t); pẖry(.t) "Medikament, Zaubermittel" |    |
| pš.t "Hälfte" |  |
| Ptḥ "Ptah [GN]" |    |
| fy "tragen" |  |
| m-ỉri̯ "[Negierung des Imperativs]" |     |
| m-bꜣḥ "vor (Gott oder König) [Präp.]" |   |
| m-sꜣ; m-sꜣ⸗ "hinter [Präp.]" |                            |
| m-sꜣ-ḫpr "aber, jedoch" |  |
| m-šs; ⸢m-šs⸣ "sehr [Adverb]" |      |
| m-ḳdy; ⸢m⸣-ḳdy; m-ḳde "in der Art von [Präp.]" |    |
| m-tw⸗ "durch [Präp.]" |  |
| m-tw⸗; m-tw "bei, jemanden gehören [Präp.]" |       |
| m-ḏr; (n)-ḏr.ṱ⸗ "bei, durch [Präp.]" |   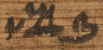    |
| mꜣỉ.w(t) "Insel" |  |
| mꜣꜥ.w; mꜣꜥ "Ort, Platz" |    |
| mꜣḫe.t; mꜣḫe(.t) "Waage" |   |
| mỉ(.t); mỉ.t "Straße" |  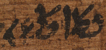 |
| my "[enklitische Partikel nach dem Imperativ]" |  |
| my; ⸢m⸣y; ⸢my⸣; me "[Imperativ von ḏi̯.t]" |    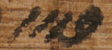     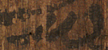 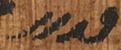  |
| myt "Weg, Rechtsanspruch" |   |
| mꜥḏy "Profit" | 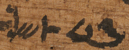  |
| mw "Wasser" |    |
| Mw(.t) "Mut [GN]" |     |
| ⸢mwt⸣; mwt "sterben" |   |
| mn; bn.ỉw "es gibt nicht [Negation der Existenz]" |        |
| [Mn]-nfr; Mn-nfr "Memphis [ON]" |    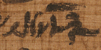 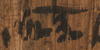 |
| mnḫ "tugendhaft, wohltätig sein [Adjektivverb]" | 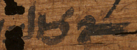   |
| mnḫ "Wohltat, gute Tat" |  |
| mnḳ "Vollendung" |    |
| mnḳ "vollenden" |   |
| mr.t "Liebe, Beliebtheit, Wunsch, Wille" |   |
| mri̯; mri̯.ṱ⸗ "lieben, wünschen" |       |
| mlẖ "Streit" |  |
| mḥ "füllen" |         |
| mḥ-10.t "zehntes" |  |
| mḥ-11 "elftes" |  |
| mḥ-12 "zwölftes" |  |
| mḥ-13 "dreizehntes" |  |
| [mḥ-14] "vierzehntes" | |
| mḥ-2 "zweiter" |      |
| mḥ-3 "dritter" |      |
| mḥ-4 "vierter" |    |
| mḥ-5 "fünfter" |    |
| mḥ-6 "sechster" |    |
| mḥ-7.t; mḥ-7 "siebtes" |    |
| mḥ-8.t "achtes" |  |
| mḥ-9.t "neuntes" | 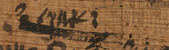 |
| mḥe.w "Flachs" |  |
| mḥtỉ "Norden" |  |
| mh̭y "gleichen, vergleichen" |  |
| mh̭y; [m]h̭y; mh̭⸢y⸣ "schlagen" |    |
| ms.t; ⸢ms⸣ "Geburt" | 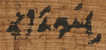  |
| msḥ.w "Krokodil" | 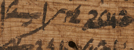 |
| mšꜥ "Armee, Volksgruppe, Menge" |   |
| mšꜥ "gehen, marschieren" |   |
| mtỉ "Flut, Wasser" | 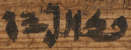 |
| mtỉ.t "Mitte" |  |
| mtw "[Bildungselement des Konjunktivs]" |         |
| mtw⸗s "[selbst. Pron. 3. Sg. f.]" |  |
| mtr "Zeuge sein, zugegen sein" |  |
| md.w(t); md(.t); ⸢md(.t)⸣; md.t; ⸢md.t⸣ "Rede, Wort, Sache, Angelegenheit" |             |
| Mdy.w; Mdy⸢.w⸣; Mdy(.w) "Meder, Perser" | 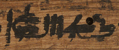 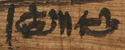          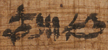 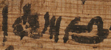  |
| n; ⸢n⸣; [n] "des [Genitiv]" |                    |
| n; n.ỉm⸗; ⸢n.ỉm⸗⸣; {r} <n> "in (< m) [Präp.]" |                                                                            |
| n; n⸗ "zu, für (< n; Dativ)" |                               |
| n.ỉm "dort [Adverb]" |   |
| n.n⸗w "für sie" |                  |
| n.n⸗s "für sie" |  |
| N(.t) "Neith [GN]" |  |
| n⸗k "für dich" |  |
| (n)-wꜥ-sp "alle zusammen" |  |
| (n)-bnr "außen, draußen [Adverb]" |  |
| (n)-pꜣ-s-2 "die zwei Personen, die beiden" |  |
| (n)-rn; (n)-rn⸗; ⸢(n)-rn⸣; (n-)rn "besagter, betreffender" |          |
| (n)-tꜣ-ḥꜣ.t "früher, vorne [Adverb]" |       |
| (n)-ṯꜣi̯-(n) "von ... an, seit [Präp.]" |  |
| n-ḏr(.t) "als, nachdem [Temporalis]" |        |
| nꜣ; ⸢nꜣ⸣ "die [def. Art. pl. c.]" |                                                                                                                         |
| nꜣ.w "[def. Art. pl. c. + Präfix der Relativform]" |      |
| nꜣ.w "[Kopula Plural]" |       |
| nꜣ.w; n⸗ỉ "für mich" |   |
| nꜣ.w-wn-nꜣ.w "[def. Artikel pl. c. + Präfix der Relativform + Imperfektkonverter]" |  |
| nꜣ-ꜥn; ꜥn "schön sein [Adjektivverb]" |    |
| nꜣ-nḫṱ "stark sein [Adjektivverb]" | 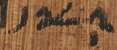 |
| nꜣ-nḏm; nḏm "angenehm sein, froh sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣy "diese [Demonstrat. pl. c.]" |    |
| nꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| nꜣy⸗w "ihre" |     |
| nꜣy⸗f "seine" |        |
| Nꜣy⸗f-ꜥw-rd.wỉ "Nepherites [KN]" |  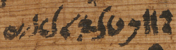 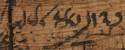 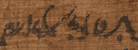  |
| nꜣy⸗n "unsere" |   |
| nꜣy⸗s "ihre" |  |
| nꜣy⸗k "deine" |  |
| nw "Zeit" |   |
| nw; ỉ:nw "sehen" |      |
| nwḥ; ỉn.nwḥ "Strick" |     |
| nb "Gold" |   |
| ⸢nb⸣ "jeder; irgendein" |  |
| nb; nb.w; ⸢nb⸣ "Herr" |        |
| nb.t "Frevel, Sünde" |  |
| nb(.t); nb.t "Herrin" |   |
| nb-n-ḫꜥi̯ "Herr der Erscheinungen" |  |
| nf "Segler" |   |
| nfr "gut sein [Adjektivverb]" |   |
| nfr "gut [Adjektiv]" |  |
| nmꜣy(.t)(?) "'Wanderin' (?)" |   |
| nhe(.t) "Sykomore" |  |
| nḫ(?)(.t) "Klage, Totenklage" | 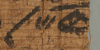 |
| nḫby(.t) "Königstitulatur" | 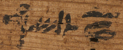 |
| Nḫṱ-nb⸗f "Nektanebos I. [KN]" |  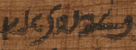 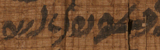 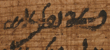     |
| nsw "König" |  |
| nk "Geschlechtsverkehr haben" |  |
| nkt "Sache" |        |
| nkt-ḥwrꜥ "Raubgut" |  |
| ntỉ; ⸢ntỉ⸣ "[Relativkonverter]" |                                                                      |
| ntỉ.ỉw; mtw "[Relativkonverter]" |                       |
| ntỉ.ỉw⸗f "[Relativkonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |  |
| ntỉ.ỉw⸗k "[Relativkonverter + Suffixpron. 2 sg. m.]" |  |
| ntỉ-ỉri̯ "[Relativkonverter + r im Futur III vor nominalem Subjekt]" |  |
| ntỉ-wꜥb "Sanktuar" |     |
| nṯr "Gott" |      |
| nṯr.w; nṯr⸢.w⸣ "Götter" |            |
| r "[im Futur III vor nominalem Subjekt]" |       |
| r "[im Futur III vor Infinitiv]" |            |
| r "macht (bei Beträgen u.ä.)" |     |
| r; ỉw; ⸢ỉw⸣ "indem, wobei [Umstandskonverter]" |                       |
| r; [r]; r.ḥr⸗ "zu, hin [Präp.]" |                                               |
| r.r⸗w "zu ihnen" |     |
| ⸢r⸣.r⸗f "zu ihm" |  |
| r.r⸗s "zu ihr" |  |
| r.r⸗k "zu dir" |   |
| r-wbꜣ "gegen, gegenüber, vor [Präp.]" |     |
| r-bw.nꜣỉ "hierher [Adverb]" |  |
| r-bnr "heraus [Adverb]" |  |
| r-hn "bis hin zu [Präp.]" |   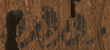 |
| r-ḥr "auf, vor [Präp.]" |    |
| r-ẖ(.t) "in der Art von, entsprechend [Präp.]" |     |
| (r)-šw "überhaupt; wieder, jemals" |  |
| (r)-ḏbꜣ; (r)-ḏbꜣ⸗; ⸢(r)-ḏbꜣ⸣; (r-)ḏbꜣ; (r-)ḏbꜣ.ṱ⸗ "wegen [Präp.]" | 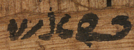    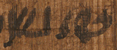  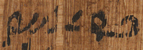    |
| Rꜥ "Re [GN]" |      |
| r:wn-nꜣ.w-⸢ỉw⸗⸣; (r:)wn-nꜣ.w; wn-nꜣ.w; ⸢wn-nꜣ⸣.w; ⸢wn⸣-nꜣ.w; wn-⸢nꜣ.w⸣ "[Präfix der Relativform + Imperfektkonverter]" |              |
| rmy "weinen, beweinen" | 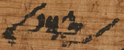  |
| rmy(.t) "Träne" |  |
| rmṯ; rmṯ.w "Mensch, Mann" |                |
| rmṯ.w-ꜥy.w "reicher, vornehmer Mann" | 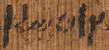 |
| rmṯ.w-rḫ.w; rmṯ-rḫ "Gelehrter" |   |
| rmṯ-(n)-ḳnḳn; rmṯ.w-(n)-ḳnḳn "Krieger" |   |
| rn "Name" |        |
| rnp(.t); rnp.w(t) "Jahr" |           |
| rḫ; ỉr.rḫ; ⸢rḫ⸣ "wissen, können" |            |
| rsỉ "Süden" |  |
| rsṱy "Morgen" |   |
| rše; ršy "sich freuen" | 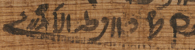  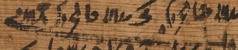  |
| ršy "Freude" |  |
| (r:)ḳd "bauen" |  |
| rd.wỉ "Fuß" |  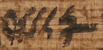  |
| lk "aufhören, beseitigen" |        |
| <mḥ-1>; mḥ-1 "erster" |   |
| <3.nw> "dritter" | |
| hꜣ; ⸢h⸣[ꜣ] "Zeit" |                 |
| hwš "schmähen, kränken" |  |
| hb "senden, schicken" |  |
| ⸢hp⸣; hp "Recht, Gesetz, Gesetzanspruch" |              |
| hri̯.w "zufrieden sein, besänftigt sein" |  |
| hrw "Tag" |    |
| Hgr; Hḳr "Hakoris [KN]" |  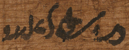 |
| htmꜣ "Thron" |  |
| ḥꜣ(.t) "vor [Präp.]" |   |
| ḥꜣ.t; ḥꜣ(.t) "Vorderteil, Anfang, Spitze" |     |
| ḥꜣ.tỉ; ḥꜣ.tỉ⸗ "Herz" |       |
| ḥꜣṱ; ḥꜣṱ.t "erster, früherer [Adjektiv]" |   |
| ḥꜥ⸗ "selbst" |   |
| ḥw "Vermehrung, Profit" |  |
| ḥw.ṱ "Ackerbauer" |  |
| Ḥw.t-nn-nsw; Ḥw.t-(nn)-nsw "Herakleopolis [ON]" |    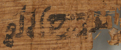   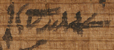   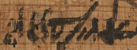 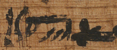 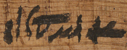 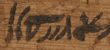  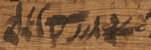  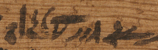 |
| ḥw(.t)-nṯr "Tempel" |    |
| ḥwe(.t); ḥwe.t; ⸢ḥwe⸣[.t] "Kapitel, Strophe" |         |
| ḥwy "Regen" |   |
| ḥwy "schlagen, werfen" |  |
| ḥwrꜥ "rauben, berauben" |   |
| ḥwrꜥ; ḥwrꜥ(.w) "Raub, Räuberei" |    |
| ḥwṱ "Mann, männlich" |  |
| ḥbs "bekleiden, bedecken" | 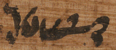 |
| ḥbs.w "Kleidung" |  |
| Ḥp "Apisstier [GN]" |         |
| ḥm.t "Frau, Ehefrau" |    |
| ḥm-nṯr; ⸢ḥm-nṯr(?)⸣ "Gottesdiener, Prophet" |     |
| ḥmꜣ.t "Gebärmutter" |   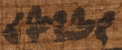 |
| ḥn; (r:)ḥn "befehlen" |           |
| ḥnꜥ "und, zusammen mit, oder [Präp.]" |  |
| ḥr "auf [Präp.]" |              |
| ḥr "Gesicht" |  |
| ḥr-ꜣt⸗ "auf [Präp.]" | 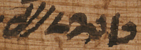 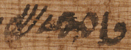 |
| Ḥr-mꜣꜥ-ḫrw "Harmachoros [PN]" |  |
| Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) "Horus, Sohn der Isis [GN]" |    |
| Ḥr-šf "Herischef [GN]" |      |
| ḥrỉ "oben [Adverb]" |       |
| ḥrỉ "Oberster, Herr, Vorgesetzter" |                                           |
| ḥrḥ "wachen, hüten" |  |
| ḥlly; ḥll "Trübung, Finsternis (?)" | 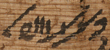  |
| ḥsb(.t); ⸢ḥsb(.t)⸣ "Regierungsjahr" |      |
| ḥḳr; ḥḳꜣ "hungern" |     |
| ḥtp-nṯr "Gottesopfer" |  |
| ḥḏ; ḥḏ.w "Silber, Geld" |    |
| ḥḏ.t "Weiße Krone" |  |
| ḫꜣ "Meßstab" |   |
| ḫꜣꜥ "werfen, legen, lassen, verlassen" |          |
| ḫꜣsy(.t); ḫꜣs.w(t); ḫꜣs(.wt) "Fremdland, Wüste, Nekropole" |        |
| h̭yh̭e "Staub" |  |
| ḫꜥ "Fest" |  |
| ḫꜥi̯ "erscheinen" |     |
| h̭wy "Weihrauch" |  |
| ḫby "vermindern, abschneiden, rasieren" |  |
| ḫpr "geschehen" |                                                            |
| ḫpr "es ist so (dass), denn, weil [Konjunktion]" |        |
| ḫpš; ḫbš "Sichelschwert" |    |
| ḫm.w "klein, jung [Adjektiv]" |  |
| ḫm-ẖr.w; ḫm-ẖr(.w) "Knabe, junger Mensch, Bursche, Kind" | 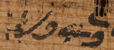 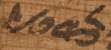   |
| Ḫmnw "Hermopolis [ON]" |  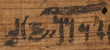 |
| ḫnṱ "stromauf fahren" |   |
| ḫr "[Präfix des Aorists]" |      |
| ḫrw "Stimme" |  |
| ḫsf "verachten, tadeln" |  |
| ḫštrpn "Satrap" | 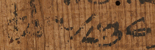 |
| ḫt(.w); ḫt "Holz, Bäume" |      |
| ẖ(.t) "Kopie, Abschrift, Wortlaut" |  |
| ẖ(.t); ẖ.w(t) "Leib, Körper" |   |
| ẖꜣ(.t) "Gemetzel" |     |
| ẖꜥ.t "Ende" |  |
| ẖn "sich nähern" |  |
| ẖn; ẖn⸗ "in [Präp.]" | 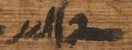       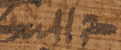     |
| H̱nm "Chnum [GN]" | 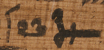  |
| ẖr "Syrer" |   |
| ẖr; ẖr.r.ḥr⸗ "unter, wegen [Präp.]" |    |
| ẖr.t "Speise, Nahrung" |  |
| ẖr-nṯr "Steinmetz" |   |
| ẖrꜣ(.t) "Gewand, Riemen" | 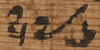 |
| ẖry.w; ẖry "Straße, Weg" |  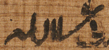 |
| ẖry.t "Witwe" |  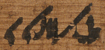 |
| ẖl "Knabe, Diener" |  |
| s "Mann, Person" |  |
| s; st; ⸢s⸣ "[enklit. Pron. 3. sg. m.]" |                               |
| s.t "Platz, Ort" |  |
| sꜣ "Phyle" |    |
| sꜣ "Sohn" |  |
| sỉ-n-ꜥḳ "Bäcker" |   |
| sꜥnḫ "ernähren, leben lassen" |  |
| sw "Monatstag" |            |
| sw-10 "Dekade" |    |
| swr "trinken" |      |
| sbꜣ.w "Tür" |   |
| sbḳ(.w) "klein, gering [Adjektiv]" |  |
| sbt "herrichten, ausrüsten, vorbereiten, versorgen" |  |
| sp "Rest" |     |
| sp "Fall, Angelegenheit, Mal" |   |
| sp-2 "zweimal [Wiederholungszeichen]" |   |
| sf "gestern [Adverb]" |   |
| s[fy] "Messer, Schwert" |  |
| smn "aufsetzen, feststellen, dauern (lassen)" |  |
| smḥ (?) "links" |    |
| smt; [s]mt "Art, Weise, Gestalt" |      |
| sn.w "Bruder" |  |
| ⸢s⸣nty "sich fürchten" |  |
| sr.w "Fürst, Beamtenschaft, Kollegium" | 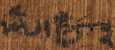   |
| sḥm.t; sḥm.w(t) "Frau" |    |
| sḥn "Krone, Diadem" |   |
| sḥn; ⸢sḥn⸣.y "Angelegenheit, Amt, Befehl, Auftrag" |   |
| sḥn.ṱ; sḥn "befehlen, beauftragen" |   |
| sḫ(.t) "Feld" |  |
| sh̭y.t; sh̭y(.t) "Schlag, Hieb; Rausch" |    |
| sẖꜣ "Schrift" |  |
| sẖꜣ; ⸢sẖꜣ⸣ "schreiben" |          |
| sẖꜣ.w "Schreiber" |  |
| sẖꜣ-ỉšr "syrische Schrift, Aramäisch" |  |
| ssw; ss.w; ⸢ss.w⸣ "Termin, Zeit" |              |
| sḳꜣ "zusammenfügen, sammeln" |  |
| sgrꜣ.w "Herde (o.ä.)" |  |
| st "[enklit. Pron. 3. pl. c.]" |  |
| stbḥ(.t) "Gerät, Waffe" |  |
| stbḥ(.t)-n-ḳnḳn "Kampfgerät, Waffen" |  |
| sṯꜣ.ṱ; ⸢sṯꜣ⸣.ṱ "(sich) zurückziehen, wenden" |    |
| sdb "essen" |  |
| sḏy "erzählen" |  |
| sḏm "hören" |   |
| sḏny "beraten" |  |
| sḏr "schlafen" |   |
| šy(.w); šy "See" |    |
| šw "Wert, Nutzen" |  |
| šbi̯.t "Veränderung, Tausch, Entgelt" |   |
| ⸢šm⸣; šm "gehen" |               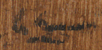      |
| šm.w "Gang, Reise" |  |
| šmsi̯(?); šmsi̯ "folgen, dienen, geleiten" |     |
| šn "Krankheit" |  |
| šn.w "Inspektion, Untersuchung" |  |
| šni̯ "fragen, suchen, untersuchen" |       |
| šni̯ "krank sein" |  |
| šnꜥ "abweisen, abhalten" |  |
| šnt(.t); ⸢šnt(.t)⸣ "Schurz, Tuch" |   |
| šrỉ "Sohn" |        |
| šll; šlly "beten, flehen" | 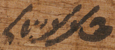  |
| šlly "Wehruf, Wehklage" | 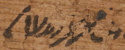 |
| šsp; ⸢šsp⸣ "empfangen" |       |
| Šsp-mr "Schepmer [PN]" |  |
| šgyg "Begier, Verlangen" | 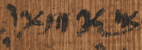 |
| šty "(Priester)einkommen" |  |
| ⸢št⸣y.w "Wald, Busch" |  |
| ḳb "verdoppeln" |  |
| ḳbꜣ(.t) "Gefäß, Krug" |  |
| ḳn "Stärke, Sieg" |  |
| ḳnḥ.t "Schrein, Naos" | 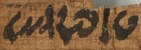 |
| ḳnḳn "schlagen, kämpfen" |    |
| ḳlꜣ.t; ḳlꜣ.w(t) "Riegel, Zapfen" |   |
| ḳlby "[Gefäßbezeichnung bzw. entsprechendes Maß]" |     |
| ḳd(.t) "Kite (1/10 Deben)" |  |
| ḳdy "umherziehen" |  |
| k.ṱ.t "andere [sg. f.]" |   |
| kꜣm "Garten" | 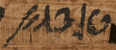 |
| kꜣmy "Gärtner, Winzer" |  |
| kỉỉ.w; kỉỉ "anderer [sg. m.]" |    |
| Kbḏe; Kbḏ "Kambyses [KN]" | 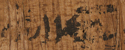  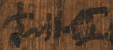    |
| Km; ⸢Km⸣ "Ägypten" |                    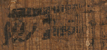      |
| kṱ.t-ẖ(.t) "andere [pl. c.]" |  |
| gy "Gestalt, Art" |   |
| gbꜣ.t "Sproß, Blatt, Nachkommenschaft" | 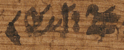 |
| gby.w "Schwacher" |  |
| gmi̯ "finden" |       |
| grp "öffnen, enthüllen, offenbaren" |  |
| grḥe "Nacht" |  |
| glw "deponieren, anvertrauen" |  |
| gsm "Sturm; Zorn" |  |
| gsgs "tanzen" |  |
| gst "Palette" |   |
| gḏwḏꜣ "Mensch aus Gaza, Diener" | 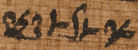 |
| tꜣ "Land, Welt, Erde" |          |
| tꜣ; ⸢tꜣ⸣ "die [def. Artikel sg. f.]" |                                                             |
| Tꜣ-ꜥꜣm(.t)-pꜣ-nḥs; Tꜣ-⸢ꜥꜣm(.t)-pꜣ⸣-nḥs "Daphnai [ON]" |   |
| Tꜣ-Mḥy "Unterägypten" |  |
| Tꜣ-Šmꜥ "Oberägypten [ON]" |   |
| tꜣỉ "[Kopula sg. f.]" |         |
| tꜣỉ "[def. Artikel sg. f. + Präfix der Relativform]" |   |
| tꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| ⸢tꜣy⸗w⸣ "ihre" |  |
| tꜣy⸗f "seine" |       |
| tꜣy⸗s "ihre" |    |
| tꜣy⸗k "deine" |     |
| ta "die von" |  |
| Ta-bꜣ.ỉyi̯ "Tabis(?)" | 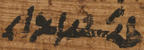 |
| tw⸗ỉ; tw⸗y "[proklit. Pron. 1. sg. c.]" |     |
| tw⸗n "[proklit. Pron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸢tw⸣⸗tn "[proklit. Pron. 2. pl. c.]" |  |
| twꜣ "Berg" |  |
| twtw "sammeln, sich versammeln" |  |
| tp.t; tp "erster [Adjektiv]" |   |
| tpy.t "Anfang" | 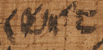 |
| tfy "wegnehmen, entfernen" |  |
| tm "[Negationsverb]" |     |
| tm-hp "Unrecht" |  |
| Tryꜣwš "Dareios [KN]" |  |
| ṱrry "Ofen" |  |
| tḥ⸢ꜣ⸣ "Bitternis, Leiden, Krankheit" |  |
| tḥꜣ "betrübt sein, bitter sein, krank sein" |  |
| tḥꜣ "berühren" |  |
| ṱḥs "salben" | 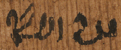 |
| tḫ(?)s(.t) "?" |  |
| tš; ⸢tš⸣.w "Bezirk, Provinz" |   |
| ṱkn "nahe kommen, eilen" |   |
| tgs.w; tgs "Bauholz" |     |
| ṯꜣi̯ "nehmen, empfangen" |     |
| dwe "Morgen" |  |
| dwn "sich erheben" |   |
| dp-n-ỉꜣw.w(t) "Vieh" |  |
| Dpꜣy; Dpꜣ; Dpyꜣ "Dep (Stadtteil von Buto) [ON]" |    |
| dmḏ "Summe" |         |
| dnỉ(.t) "Anteil" |  |
| dšry(.t) "Rote Krone" |  |
| ḏꜣḏꜣ "Kopf" |     |
| ḏi̯; ḏi̯.t; ḏi̯⸗; ⸢ḏi̯.t⸣ "geben" |                                                         |
| ḏi̯.t st; ⸢ḏi̯.t st⸣ "[Infinitiv + enklit. Pron. 3. pl. c., Haplographie]" |         |
| ḏwf "Papyrus (Pflanze)" |  |
| ḏm "Geschlecht, Nachkomme, Generation; Jungmannschaft; Kalb" |  |
| ḏmꜥ; ḏm⸢ꜥ⸣ "Papyrusrolle, Buch" |     |
| ḏmꜥy "trauern, klagen" | 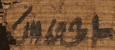 |
| ḏn⸢f⸣; ḏnf "Gewicht, Maß, Gleichgewicht" |   |
| ḏr(.t); ḏr(.t)⸗ "Hand" |    |
| ḏr⸗ "ganz, alle" |    |
| ḏrꜣ; ḏ⸢r⸣ꜣ "stark, siegreich sein [Adjektivverb]" |     |
| ḏlḏ "Pflanzung, Hecke (?)" |   |
| Ḏḥw.tỉ "Thot [GN]" |   |
| Ḏd "Djed-Pfeiler" |   |
| ḏd; ⸢ḏd⸣ "[Konjunktion]" |                                                                                                          |
| ḏd.ṱ; ḏd; (r:)ḏd; ⸢ḏd⸣ "sagen, sprechen" |                                           |
| Ḏd-ḥr "Tachos, Taos [KN]" | 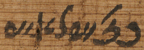 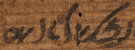 |
| 1; (sw)-1 "Tag 1" |     |
| 10 "10" |  |
| 13 "13" |  |
| 16 "16" |   |
| 160.532 "160.532" | 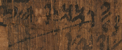 |
| 170.210 "170.210" |  |
| 18 "18" |   |
| 19 "19" | 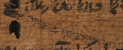  |
| 2 "(Tag) 2" |  |
| 2 "2" |  |
| 2.nw; {2.nw} "zweiter" |   |
| 27 "27" |  |
| 3 "(Tag) 3" |  |
| 3; 3.t "3" |            |
| 376.800 "376.800" |  |
| 4 "(Tag) 4" |  |
| 44; 44.t "44" |   |
| 5 "(Tag) 5" |  |
| 5.t; 5 "5" |    |
| 6 "(Tag) 6" |  |
| 6 "6" |   |
| 6.000 "6.000" |  |
| 7 "7" |  |
| 7; (sw)-7 "(Tag) 7" |   |
| 8 "8" |   |
| 𓂞'𓏲 | 𓂞𓏲 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |  |
| :**𓅓1𓄿1** | :𓅓𓄿 |  |
| :𓎆 | :𓎆 |    |
| :𓏾 | :𓏾 |  |
| :𓐀 | :𓐀 |  |
| :𓐂 | :𓐂 |  |
| 𓀀1 | 𓀀 |    |
| 𓀀3 | 𓀀 |      |
| 𓀀:𓈖 |   | |
| 𓀁 | 𓀁 |                                                                                                                                     |
| 𓀁1 | 𓀁 |    |
| 𓀁° | 𓀁 |                             |
| 𓀋:° | 𓀋 |   |
| 𓀎 | 𓀎 |    |
| 𓀎𓏰:𓀀 | 𓀎 |  |
| 𓀎𓏰:𓀀𓀁 | 𓀎 |   |
| 𓀐 | 𓀐 |                                                                |
| 𓀐1 | 𓀐 |   |
| 𓀒1 | 𓀒 |  |
| 𓀔 | 𓀔 |                               |
| 𓀔:𓏥 |  | |
| 𓀗 | 𓀗 |       |
| 𓀙 | 𓀙 |    |
| 𓀙𓇋𓏲 | 𓀙𓇋𓏲 |    |
| 𓀞 | 𓀞 |  |
| 𓀢2 | 𓀢 |  |
| 𓀨 | 𓀨 |   |
| 𓀹1 | 𓀹 |  |
| 𓀼 | 𓀼 |   |
| 𓀾1 | 𓀾 |   |
| 𓁀:𓂡 |   | |
| 𓁀:𓂡𓍱 |  | |
| 𓁐9 | 𓁐 |        |
| 𓁗1 | 𓁗 |   |
| 𓁗1:° | 𓁗 |  |
| 𓁶𓏤1 | 𓁶𓏤 |      |
| 𓁶𓏤1𓊪1 | 𓁶𓏤𓊪 |  |
| 𓁶𓏤1𓊪1:° | 𓁶𓏤𓊪 |    |
| 𓁷𓏤 | 𓁷𓏤 |                                  |
| 𓁷𓏤1𓀀3 | 𓁷𓏤𓀀 |   |
| 𓁹:𓂋*𓏭 |                                                                                                      | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑 |                     | |
| 𓁹:𓂋*𓏭𓆑1 |    | |
| 𓁹:𓏏*𓏤𓁻1 |   | |
| 𓁻2 | 𓁻 |    |
| 𓁻:° | 𓁻 |                      |
| 𓂊 | 𓂊 |  |
| 𓂊2:° | 𓂊 |   |
| 𓂋 | 𓂋 |                   |
| 𓂋1 | 𓂋 |                                                                                                                  |
| 𓂋1𓂋:𓆑 | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓎡° | 𓂋 |  |
| 𓂋1𓂋:𓏥𓏲 | 𓂋 |     |
| 𓂋1𓏌:𓈖 | 𓂋 |  |
| 𓂋3𓌥 | 𓂋𓌥 |            |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1'𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲 |   |
| 𓂋3𓌥𓃀3𓏲1𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲𓏲 |        |
| 𓂋3𓌥𓃀𓏲1𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓃀𓏲𓏲 |  |
| 𓂋3𓌥𓏲𓏭:𓏛 | 𓂋𓌥𓏲 |  |
| 𓂋4 | 𓂋 |  |
| 𓂋:𓂋 |    | |
| 𓂋:𓂧 |      | |
| 𓂋:𓂧:° |  | |
| 𓂋:𓂧:°𓌗1 |  | |
| 𓂋:𓂧@ |   | |
| 𓂋:𓂧@𓂾𓂾 |   | |
| 𓂋:𓂧𓂾𓂾 |  | |
| 𓂋:𓂧𓌗1 |    | |
| 𓂋:𓂧𓌗2 |  | |
| 𓂋:𓆑 |  | |
| 𓂋:𓊃 |  | |
| 𓂋:𓊪 |       | |
| 𓂋:𓊪° |   | |
| 𓂋:𓍿𓀀𓏪 |                   | |
| 𓂋:𓎡 |  | |
| 𓂋:𓎡° |  | |
| 𓂋:𓏏*𓏰 |              | |
| 𓂋:𓏥𓏲 |     | |
| 𓂋:𓐍 |                | |
| 𓂋:𓐍@1 |  | |
| 𓂓𓏤1 | 𓂓𓏤 |  |
| 𓂓𓏤2 | 𓂓𓏤 |   |
| 𓂙:𓈖2 |  | |
| 𓂙:𓈖2:𓏏*𓏰 |  | |
| 𓂚3 | 𓂚 |  |
| 𓂚3𓍘𓇋4 | 𓂚𓍘𓇋 |  |
| 𓂜1 | 𓂜 |   |
| 𓂜1:𓅪 |    | |
| 𓂝 | 𓂝 |               |
| 𓂝1 | 𓂝 |  |
| 𓂝:𓂝 |    | |
| 𓂝:𓂝:° |  | |
| 𓂝:𓂝:°𓏤 |  | |
| 𓂝:𓂝𓏤 |     | |
| 𓂝:𓂻 |          | |
| 𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥 |       | |
| 𓂝:𓈖 |     | |
| 𓂝:𓈖:° |  | |
| 𓂝:𓈖𓏌𓏲1 |     | |
| 𓂝:𓈙𓀞2 |      | |
| 𓂞'𓏲 | 𓂞𓏲 |      |
| 𓂞:𓏏2 |           | |
| 𓂞:𓏏3 |                           | |
| 𓂞:𓏏3 𓏞𓍼:𓏤@ |  | |
| 𓂞:𓏏3𓋴𓏏3𓏏 |         | |
| 𓂞:𓏏6 |                    | |
| 𓂞:𓏏6𓏲 |                    | |
| 𓂞𓏲1 | 𓂞𓏲 |  |
| 𓂧 | 𓂧 |      |
| 𓂧':𓏭 |               | |
| 𓂧:**𓅓1𓏭** |  | |
| 𓂧:𓏏*𓏤 |              | |
| 𓂭:𓎆 |  | |
| 𓂭:𓎈 |  | |
| 𓂭:𓏿 |  | |
| 𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 |    |
| 𓂷:𓂡1 |      | |
| 𓂷:𓂡1:° |  | |
| 𓂸:𓏏 |     | |
| 𓂸:𓏏𓂭𓂭 |    | |
| 𓂺1 | 𓂺 |  |
| 𓂺4 | 𓂺 |  |
| 𓂻 | 𓂻 |                     |
| 𓂻1:° | 𓂻 |  |
| 𓂻:° | 𓂻 |                                            |
| 𓂼 | 𓂼 |   |
| 𓂼1 | 𓂼 |   |
| 𓂼2 | 𓂼 |   |
| 𓂼2𓂼1 | 𓂼𓂼 |   |
| 𓂼𓏲1𓂼 | 𓂼𓏲𓂼 |  |
| 𓂽 | 𓂽 |   |
| 𓂽1 | 𓂽 |      |
| 𓂽:° | 𓂽 |  |
| 𓂾𓂾 | 𓂾𓂾 |    |
| 𓃀 | 𓃀 |     |
| 𓃀3𓏲1 | 𓃀𓏲 |             |
| 𓃀4𓏲4 | 𓃀𓏲 |      |
| 𓃀:𓈖1 |                              | |
| 𓃀:𓈖1:° |         | |
| 𓃀:𓈖1:°𓊪:𓏭2 |  | |
| 𓃀:𓈖1𓊪:𓏭2 |                       | |
| 𓃀𓏲1 | 𓃀𓏲 |                       |
| **𓃀𓏲1𓅃𓅆'**:𓎡1 |  | |
| 𓃂 | 𓃂 |                     |
| 𓃂𓈘:𓈇 | 𓃂 |     |
| 𓃂𓈘:𓈇:° | 𓃂 |               |
| 𓃂𓈘:𓈇° | 𓃂 |   |
| 𓃛 | 𓃛 |     |
| 𓃛𓃛 | 𓃛𓃛 |   |
| 𓃭 | 𓃭 |                                                     |
| 𓃭𓏤 | 𓃭𓏤 |                                |
| 𓃹:𓈖 |                         | |
| 𓃹:𓈖2 |            | |
| 𓃹:𓈖𓏌𓏲1 |    | |
| 𓄂:𓏏*𓏤 |                  | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤1𓄣𓏤 |     | |
| 𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤 |    | |
| 𓄋:𓊪1 |   | |
| 𓄋:𓊪@ |        | |
| 𓄋:𓊪@𓏲𓏭:𓏛 |      | |
| 𓄑:𓏛 |   | |
| 𓄑:𓏛1 |                               | |
| 𓄑:𓏛@ |   | |
| 𓄕 | 𓄕 |    |
| 𓄕𓅓𓏭:𓏛 | 𓄕𓅓 |    |
| 𓄖:𓂻 |        | |
| 𓄛1 | 𓄛 |        |
| 𓄛2 | 𓄛 |   |
| 𓄞:𓂧 |  | |
| 𓄟1 | 𓄟 |   |
| 𓄡:𓏏*𓏤 |     | |
| 𓄡:𓏏*𓏤@ |      | |
| 𓄣1𓏤1 | 𓄣𓏤 |  |
| 𓄣𓏤 | 𓄣𓏤 |         |
| 𓄤 | 𓄤 |         |
| 𓄤𓏭:𓏛 | 𓄤 |        |
| 𓄧 | 𓄧 |    |
| 𓄹:𓏭 |                                                      | |
| 𓄹:𓏭1 |   | |
| 𓄿 | 𓄿 |            |
| 𓄿1 | 𓄿 |                                                                                     |
| 𓄿3 | 𓄿 |  |
| 𓄿:° | 𓄿 |          |
| 𓄿:°𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |  |
| 𓄿𓏏𓄧 | 𓄿𓏏𓄧 |   |
| 𓅃𓅆 | 𓅃𓅆 |      |
| 𓅆 | 𓅆 |                                                                                                                                         |
| 𓅆@ | 𓅆 |            |
| 𓅆@° | 𓅆 |   |
| 𓅆° | 𓅆 |      |
| 𓅐 | 𓅐 |      |
| 𓅐𓏏:𓆇 | 𓅐 |    |
| 𓅐𓏲2𓏏:𓆇 | 𓅐𓏲 |  |
| 𓅓 | 𓅓 |                                                            |
| 𓅓'𓎔 | 𓅓𓎔 |  |
| 𓅓1 | 𓅓 |                                                                                                    |
| 𓅓1:𓏭 |   | |
| 𓅓1𓂸:𓏏 | 𓅓 |  |
| 𓅓1𓄛2 | 𓅓𓄛 |  |
| 𓅓1𓄿1 | 𓅓𓄿 |  |
| 𓅓1𓅐𓏏:𓆇 | 𓅓𓅐 |  |
| 𓅓1𓈖:𓏥 | 𓅓 |    |
| 𓅓1𓍱𓏤1 | 𓅓𓍱𓏤 |  |
| 𓅓1𓏲𓏭:𓏛 | 𓅓𓏲 |  |
| 𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓅓𓐠𓏤 |                             |
| 𓅓:𓏏 |    | |
| 𓅓:𓏏𓀐 |    | |
| 𓅓𓁹 | 𓅓𓁹 |     |
| 𓅓𓂺:𓏤 | 𓅓 |   |
| 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 | 𓅓𓇇𓇋𓇋𓏲 |  |
| 𓅓𓎔 | 𓅓𓎔 |          |
| 𓅓𓏭 | 𓅓𓏭 |    |
| 𓅓𓏭:𓏛 | 𓅓 |         |
| 𓅓𓏭:𓏛@ | 𓅓 |         |
| 𓅘 | 𓅘 |   |
| 𓅝:𓏏*𓏭 |   | |
| 𓅝:𓏏*𓏭𓅆 |   | |
| 𓅠 | 𓅠 |       |
| 𓅠𓏭:𓏛 | 𓅠 |       |
| 𓅡◳𓏤 |                                  | |
| 𓅨:𓂋*𓏰 |          | |
| 𓅪 | 𓅪 |         |
| 𓅪:° | 𓅪 |        |
| 𓅬 | 𓅬 |   |
| 𓅬3 | 𓅬 |      |
| 𓅬◳𓀀 |  | |
| 𓅯𓄿 | 𓅯𓄿 |                                                                                                                                                                                                        |
| 𓅯𓄿3 | 𓅯𓄿 |  |
| 𓅯𓄿𓂞𓏲1 | 𓅯𓄿𓂞𓏲 |  |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋 | 𓅯𓄿𓇋𓇋 |     |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓅯𓄿𓇋𓇋 |     |
| 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 | 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 |                                   |
| 𓅯𓄿𓇋𓏲𓆑 | 𓅯𓄿𓇋𓏲𓆑 |  |
| 𓅯𓄿𓏭1 | 𓅯𓄿𓏭 |                                          |
| 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 | 𓅯𓄿𓏲 |      |
| 𓅱 | 𓅱 |             |
| 𓅱𓃀4𓏲4 | 𓅱𓃀𓏲 |      |
| 𓅱𓄋:𓊪@ | 𓅱 |  |
| 𓆄 | 𓆄 |     |
| 𓆇:𓏤 |    | |
| 𓆈:𓏥 |      | |
| 𓆊 | 𓆊 |        |
| 𓆎 | 𓆎 |  |
| 𓆎@2 | 𓆎 |                           |
| 𓆎@2𓅓1 | 𓆎𓅓 |                   |
| 𓆎@2𓅓𓏭:𓏛 | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆎@2𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |        |
| 𓆎𓅓𓏭:𓏛@ | 𓆎𓅓 |  |
| 𓆑 | 𓆑 |                                                                                                                                                                 |
| 𓆑1 | 𓆑 |           |
| 𓆑1𓅆 | 𓆑𓅆 |        |
| 𓆑4 | 𓆑 |     |
| 𓆑:𓏭 |          | |
| 𓆓:𓂧 |                                                                                                                                                          | |
| 𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3 |   | |
| 𓆙 | 𓆙 |             |
| 𓆛:𓈖 |    | |
| 𓆣:𓂋𓏲 |                                                                     | |
| 𓆤1 | 𓆤 |   |
| 𓆤1:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓆮 | 𓆮 |        |
| 𓆰:𓈖𓏪:° |        | |
| 𓆰𓏪 | 𓆰𓏪 |       |
| 𓆰𓏪@1 | 𓆰𓏪 |               |
| 𓆱:𓏏*𓏤 |                                | |
| 𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥:° |       | |
| 𓆱:𓏥:° |       | |
| 𓆳 | 𓆳 |           |
| 𓆳𓏏:𓊗3 | 𓆳 |      |
| 𓆳𓏤𓏰:𓇳5 | 𓆳𓏤 |           |
| 𓆷 | 𓆷 |      |
| 𓆷1 | 𓆷 |        |
| 𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳1 | 𓆷𓏰𓏰 |     |
| 𓆸 | 𓆸 |        |
| 𓆼 | 𓆼 |               |
| 𓆼1 | 𓆼 |           |
| 𓆼𓄿3 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿3𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓆼𓄿5 | 𓆼𓄿 |         |
| 𓆼𓄿5𓂝:𓂻 | 𓆼𓄿 |         |
| 𓆼𓄿𓂝:𓂻1 | 𓆼𓄿 |  |
| 𓇁 | 𓇁 |   |
| 𓇇 | 𓇇 |  |
| 𓇋 | 𓇋 |  |
| 𓇋1 | 𓇋 |                     |
| 𓇋1𓇋𓀀 | 𓇋𓇋𓀀 |    |
| 𓇋1𓏏:𓆑 | 𓇋 |    |
| 𓇋2 | 𓇋 |              |
| 𓇋2𓂋:𓊪 | 𓇋 |           |
| 𓇋2𓆛:𓈖 | 𓇋 |    |
| 𓇋2𓊪1 | 𓇋𓊪 |   |
| 𓇋5 | 𓇋 |           |
| 𓇋5:𓎡 |           | |
| 𓇋𓀁 | 𓇋𓀁 |                |
| 𓇋𓀁1 | 𓇋𓀁 |                                           |
| 𓇋𓀁1𓋴𓏏 | 𓇋𓀁𓋴𓏏 |   |
| 𓇋𓀁𓂋:𓎡 | 𓇋𓀁 |  |
| 𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤 | 𓇋𓀁 |              |
| 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛 | 𓇋𓀁𓏤 |          |
| 𓇋𓂋:𓏭 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓂋:𓏭𓀹1 | 𓇋 |  |
| 𓇋𓇋 | 𓇋𓇋 |                 |
| 𓇋𓇋𓅱:𓎡 | 𓇋𓇋 |          |
| 𓇋𓇋𓆑 | 𓇋𓇋𓆑 |     |
| 𓇋𓇋𓏲 | 𓇋𓇋𓏲 |                                                                                                                                                                                        |
| 𓇋𓈖 | 𓇋𓈖 |           |
| 𓇋𓋴𓏏 | 𓇋𓋴𓏏 |                           |
| 𓇋𓎛𓃒 | 𓇋𓎛𓃒 |      |
| 𓇋𓏠:𓈖 | 𓇋 |     |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆 | 𓇋 |    |
| 𓇋𓏠:𓈖𓅆° | 𓇋 |  |
| 𓇋𓏲 | 𓇋𓏲 |                                                                                                                                                        |
| 𓇋𓏲 𓏪3 | 𓇋𓏲 𓏪 |  |
| 𓇋𓏲1 | 𓇋𓏲 |  |
| 𓇋𓏲𓆑 | 𓇋𓏲𓆑 |                               |
| 𓇋𓏲𓏪 | 𓇋𓏲𓏪 |   |
| 𓇍1𓇋1 | 𓇍𓇋 |             |
| 𓇍1𓇋1𓂻 | 𓇍𓇋𓂻 |             |
| 𓇏:° | 𓇏 |  |
| 𓇓1 | 𓇓 |                   |
| 𓇓1𓅆 | 𓇓𓅆 |          |
| 𓇔3 | 𓇔 |  |
| 𓇔3𓏤𓏰:𓊖1 | 𓇔𓏤 |  |
| 𓇘 | 𓇘 |   |
| 𓇘:𓏏*𓏰𓅓 |   | |
| 𓇛1 | 𓇛 |   |
| 𓇣𓂧:𓏏*𓏰𓌽:𓏥1 | 𓇣 |   |
| 𓇥:𓂋1 |       | |
| 𓇥:𓂋1𓏭:𓏛 |   | |
| 𓇥:𓂋1𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2 |   | |
| 𓇥:𓂋2𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇥:𓂋2𓏲𓏭:𓏛 |  | |
| 𓇯 | 𓇯 |                                                 |
| 𓇳 | 𓇳 |                            |
| 𓇳𓅆 | 𓇳𓅆 |      |
| 𓇳𓍼:𓏤 | 𓇳 |     |
| 𓇳𓍼:𓏤° | 𓇳 |  |
| 𓇳𓏤 | 𓇳𓏤 |     |
| 𓇹 | 𓇹 |   |
| 𓇹:𓇼 |   | |
| 𓇹:𓇼:𓇳 |   | |
| 𓇺:𓏺 |  | |
| 𓇺:𓏺1 |  | |
| 𓇺:𓏻1 |     | |
| 𓇺:𓏼@ |        | |
| 𓇺:𓏽@ |   | |
| 𓇾:𓏤@ |        | |
| 𓇾:𓏤𓈇@ |   | |
| 𓈉2 | 𓈉 |        |
| 𓈉2:𓏏*𓏤 |        | |
| 𓈌 | 𓈌 |   |
| 𓈌:𓏏*𓏰 |   | |
| 𓈍:𓂝*𓏛 |      | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆 |    | |
| 𓈍:𓂝*𓏛𓅆° |  | |
| 𓈎 | 𓈎 |                        |
| 𓈎:° | 𓈎 |  |
| 𓈎:𓈖 |     | |
| 𓈎:𓈖@ |         | |
| 𓈎:𓈖@𓏌𓏲1 |    | |
| 𓈎:𓈖𓏌𓏲1 |   | |
| 𓈐':𓏏*𓏤 |      | |
| 𓈐:𓂻 |        | |
| 𓈐:𓂻@ |   | |
| 𓈒 | 𓈒 |  |
| 𓈒:𓏥 |  | |
| 𓈒:𓏥1 |    | |
| 𓈒:𓏥2 |   | |
| 𓈔 | 𓈔 |   |
| 𓈖 | 𓈖 |                                                                             |
| 𓈖1 | 𓈖 |                          |
| 𓈖1:**𓄿1'𓇋𓇋𓏲** |    | |
| 𓈖1:**𓇛1𓅓1** |   | |
| 𓈖1:𓏭 |   | |
| 𓈖2 | 𓈖 |                                                             |
| 𓈖2:𓄿1𓇋𓇋 |   | |
| 𓈖2:𓈖:𓏲*𓏥 |  | |
| 𓈖2:𓌳 |  | |
| 𓈖2:𓌳° |  | |
| 𓈖:𓀀° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖 |                | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:° |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁 |  | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁 |               | |
| 𓈖:𓂋:𓈖𓀁° |  | |
| 𓈖:𓄿 |                                                                                                                                            | |
| 𓈖:𓄿° |                                | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |  | |
| 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑 |   | |
| 𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4 |          | |
| 𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥 |               | |
| 𓈖:𓈖9 |   | |
| 𓈖:𓈖9:° |  | |
| 𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 |       | |
| 𓈖:𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖:𓊃 |  | |
| 𓈖:𓊃𓋴𓏏 |  | |
| 𓈖:**𓋴𓆰:𓈖𓏪:°** |        | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲 |            | |
| 𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1 |         | |
| 𓈖:𓎡2 |  | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 |        | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 |    | |
| 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏲𓏭:𓏛 |     | |
| 𓈖:𓏌*𓏲 |                    | |
| 𓈖:𓏌*𓏲1 |  | |
| 𓈖:𓏏 |  | |
| 𓈖:𓏏*𓏭1 |                                                                                              | |
| 𓈖:𓏥 |        | |
| 𓈖:𓏥:° |   | |
| 𓈖:𓏲*𓏥 |                    | |
| 𓈖:𓏲*𓏥1 |  | |
| 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 | 𓈖𓇋𓅓 |                                    |
| 𓈗 | 𓈗 |             |
| 𓈗𓈘:𓈇 | 𓈗 |             |
| 𓈘:𓈇 |                 | |
| 𓈘:𓈇:° |               | |
| 𓈘:𓈇° |   | |
| 𓈙 | 𓈙 |                       |
| 𓈝 | 𓈝 |                        |
| 𓈝𓂻:° | 𓈝𓂻 |                        |
| 𓉐2 | 𓉐 |          |
| 𓉐:𓉻 |                                                | |
| 𓉐:𓉻𓅆 |                                                | |
| 𓉐𓏤 | 𓉐𓏤 |                                                |
| 𓉐𓏤1 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@1 | 𓉐𓏤 |                                           |
| 𓉐𓏤@1𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |   |
| 𓉐𓏤@2 | 𓉐𓏤 |    |
| 𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰 | 𓉐𓏤 |            |
| 𓉔 | 𓉔 |                                           |
| 𓉔1 | 𓉔 |       |
| 𓉗1 | 𓉗 |                          |
| 𓉗1:𓉐2 |   | |
| 𓉗1:𓉐𓏤 |  | |
| 𓉗1𓉐𓏤@1 | 𓉗𓉐𓏤 |                 |
| 𓉞 | 𓉞 |   |
| 𓉺1 | 𓉺 |  |
| 𓉺1:𓏏*𓏰𓏌 |  | |
| 𓉻 | 𓉻 |       |
| 𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 |        | |
| 𓉻:𓂝*𓏛 |                                                                   | |
| 𓉿:𓂡1 |            | |
| 𓊃 | 𓊃 |           |
| 𓊃4 | 𓊃 |   |
| 𓊃:𓀀:𓈖 |   | |
| 𓊃:𓀀:𓈖𓅓𓏏:𓎡 |   | |
| 𓊃:𓈞𓁐2 |      | |
| 𓊌1 | 𓊌 |         |
| 𓊏 | 𓊏 |        |
| 𓊏𓏭:𓏛 | 𓊏 |        |
| 𓊑1 | 𓊑 |     |
| 𓊖 | 𓊖 |  |
| 𓊗:𓏻1 |        | |
| 𓊡 | 𓊡 |        |
| 𓊡𓏭:𓏛 | 𓊡 |  |
| 𓊡𓏲𓏭:𓏛 | 𓊡𓏲 |       |
| 𓊢𓂝:𓂻 | 𓊢 |     |
| 𓊤 | 𓊤 |    |
| 𓊤𓏲 | 𓊤𓏲 |    |
| 𓊨 | 𓊨 |    |
| 𓊨2 | 𓊨 |  |
| 𓊨2𓏏:𓆇1 | 𓊨 |  |
| 𓊨:° | 𓊨 |   |
| 𓊨:°𓏤𓉐𓏤 | 𓊨𓏤𓉐𓏤 |  |
| 𓊨𓏏:𓆇1 | 𓊨 |    |
| 𓊪 | 𓊪 |          |
| 𓊪1 | 𓊪 |                        |
| 𓊪1:° | 𓊪 |     |
| 𓊪1:𓉐𓏤1 |   | |
| 𓊪:° | 𓊪 |    |
| 𓊪:𓏏𓎛 |    | |
| 𓊪:𓏏𓎛𓅆 |    | |
| 𓊪:𓏭 |       | |
| 𓊪:𓏭2 |                       | |
| 𓊮 | 𓊮 |     |
| 𓊮2 | 𓊮 |  |
| 𓊵:𓏏@1 |  | |
| 𓊹 | 𓊹 |            |
| 𓊹𓅆 | 𓊹𓅆 |    |
| 𓊹𓅆° | 𓊹𓅆 |   |
| 𓊹𓊹𓊹 | 𓊹𓊹𓊹 |       |
| 𓊹𓊹𓊹1 | 𓊹𓊹𓊹 |          |
| 𓊹𓍛𓏤:𓀀 | 𓊹𓍛 |     |
| 𓊽 | 𓊽 |   |
| 𓊽1 | 𓊽 |   |
| 𓊽1𓊽1 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓊽𓊽 | 𓊽𓊽 |  |
| 𓋀 | 𓋀 |     |
| 𓋀𓏤 | 𓋀𓏤 |    |
| 𓋀𓏤𓏰:𓊖3 | 𓋀𓏤 |  |
| 𓋁𓃀1 | 𓋁𓃀 |  |
| 𓋁𓃀1𓏤𓊖 | 𓋁𓃀𓏤𓊖 |  |
| 𓋋:𓏏*𓆇 |  | |
| 𓋞:𓈒*𓏥1 |   | |
| 𓋩1 | 𓋩 |   |
| 𓋩2 | 𓋩 |  |
| 𓋴 | 𓋴 |                                                                       |
| 𓋴@𓏤 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴@𓏤𓄹:𓏭 | 𓋴𓏤 |    |
| 𓋴𓀀 | 𓋴𓀀 |  |
| 𓋴𓇋1𓅨:𓂋*𓏰 | 𓋴𓇋 |       |
| 𓋴𓏏 | 𓋴𓏏 |                                                                                     |
| 𓋴𓏏1𓏏 | 𓋴𓏏𓏏 |       |
| 𓋴𓏏@ | 𓋴𓏏 |    |
| 𓋹𓈖:𓐍 | 𓋹 |          |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |          |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏2 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |                                                      |
| 𓋹𓍑𓋴𓏏4 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 |           |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰 | 𓌃 |             |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁 | 𓌃 |         |
| 𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁° | 𓌃 |     |
| 𓌉 | 𓌉 |  |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥 | 𓌉 |   |
| 𓌉𓋞:𓈒*𓏥1 | 𓌉 |       |
| 𓌗1 | 𓌗 |     |
| 𓌗2 | 𓌗 |  |
| 𓌙 | 𓌙 |   |
| 𓌙:𓈉 |                   | |
| 𓌙:𓈉1 |             | |
| 𓌙𓅓1 | 𓌙𓅓 |   |
| 𓌞:𓊃 |   | |
| 𓌞:𓊃1 |   | |
| 𓌞:𓊃1𓂻:° |   | |
| 𓌞:𓊃𓇋𓏲𓂻 |   | |
| 𓌡:𓂝*𓏤3 |             | |
| 𓌢° | 𓌢 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡 | 𓌤𓏲𓏲 |  |
| 𓌨:𓂋𓏭:𓏛 |       | |
| 𓌪:𓂡 |      | |
| 𓌳 | 𓌳 |  |
| 𓌳° | 𓌳 |  |
| 𓌶:𓂝2 |     | |
| 𓌶:𓂝2𓆄 |     | |
| 𓌻 | 𓌻 |          |
| 𓌻𓀁 | 𓌻𓀁 |   |
| 𓌻𓏭:𓏛1𓀁 | 𓌻 |        |
| 𓌽:𓏥𓏤 |  | |
| 𓍃 | 𓍃 |      |
| 𓍃𓅓𓏭:𓏛 | 𓍃𓅓 |     |
| 𓍃𓏭:𓏛 | 𓍃 |  |
| 𓍊𓏤 | 𓍊𓏤 |      |
| 𓍑 | 𓍑 |                       |
| 𓍑𓄿3 | 𓍑𓄿 |                |
| 𓍑𓍑 | 𓍑𓍑 |     |
| 𓍓1 | 𓍓 |  |
| 𓍓1𓄿3 | 𓍓𓄿 |  |
| 𓍘 | 𓍘 |  |
| 𓍘1 | 𓍘 |                     |
| 𓍘1𓎟:𓏏1 | 𓍘 |        |
| 𓍘𓇋2 | 𓍘𓇋 |    |
| 𓍘𓇋4 | 𓍘𓇋 |        |
| 𓍘𓈖:𓏏 | 𓍘 |  |
| 𓍘𓈖:𓏏1 | 𓍘 |  |
| 𓍣 | 𓍣 |  |
| 𓍦 | 𓍦 |  |
| 𓍩 | 𓍩 |  |
| 𓍬:𓂻 |   | |
| 𓍬:𓂻':° |  | |
| 𓍬:𓂻2:° |   | |
| 𓍬:𓂻2:°𓍘1 |  | |
| 𓍯 | 𓍯 |                                            |
| 𓍱 | 𓍱 |        |
| 𓍱1 | 𓍱 |  |
| 𓍱:𓂡1 |    | |
| 𓍱:𓂡1𓏏 |    | |
| 𓍱@𓏤 | 𓍱𓏤 |   |
| 𓍱@𓏤𓏛:𓏫:° | 𓍱𓏤 |   |
| 𓍱𓏤1𓏛:𓏫:° | 𓍱𓏤 |   |
| 𓍱𓏤𓏛:𓏫:° | 𓍱𓏤 |  |
| 𓍴 | 𓍴 |       |
| 𓍴1 | 𓍴 |  |
| 𓍴1𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖9 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |       |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰 | 𓍴 |  |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2 | 𓍴 |    |
| 𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓋩2 | 𓍴 |  |
| 𓍸𓏛1 | 𓍸𓏛 |  |
| 𓍹 | 𓍹 |                                                                     |
| 𓍺 | 𓍺 |                              |
| 𓍼:𓏤1 |   | |
| 𓍼:𓏥 |  | |
| 𓎃° | 𓎃 |    |
| 𓎆 | 𓎆 |              |
| 𓎇 | 𓎇 |  |
| 𓎈 | 𓎈 |  |
| 𓎉 | 𓎉 |   |
| 𓎔 | 𓎔 |  |
| 𓎔2 | 𓎔 |                |
| 𓎔2: | 𓎔: |          |
| 𓎔:𓏏*𓏏 |  | |
| 𓎔:𓏏*𓏏𓏤𓊖 |  | |
| 𓎔:𓏺 |   | |
| 𓎔:𓏻 |      | |
| 𓎔:𓏼 |      | |
| 𓎔:𓏽 |    | |
| 𓎛 | 𓎛 |         |
| 𓎛1 | 𓎛 |  |
| 𓎛2 | 𓎛 |         |
| 𓎛2𓐑:𓊪1𓅆 | 𓎛 |  |
| 𓎛2𓐑:𓊪𓏲1 | 𓎛 |        |
| 𓎛𓂝:𓏏𓄹 | 𓎛 |   |
| 𓎛𓈖:𓂝 | 𓎛 |  |
| 𓎝𓎛 | 𓎝𓎛 |   |
| 𓎝𓎛𓏰:𓏛 | 𓎝𓎛 |  |
| 𓎟:𓏏 |        | |
| 𓎟:𓏏1 |       | |
| 𓎡 | 𓎡 |                             |
| 𓎡1 | 𓎡 |             |
| 𓎡1:𓇋1𓇋𓀀 |    | |
| 𓎡:𓍘𓇋 |    | |
| 𓎨 | 𓎨 |           |
| 𓎭 | 𓎭 |    |
| 𓎱1 | 𓎱 |      |
| 𓎱1:𓇳 |    | |
| 𓎱1:𓏰:𓇳1 |   | |
| 𓎸 | 𓎸 |   |
| 𓎸1 | 𓎸 |  |
| 𓎸𓅓𓏰:𓇳1 | 𓎸𓅓 |   |
| 𓎼 | 𓎼 |                         |
| 𓏇1 | 𓏇 |   |
| 𓏇1𓇋1 | 𓏇𓇋 |   |
| 𓏌 | 𓏌 |                |
| 𓏌:𓈖 |              | |
| 𓏌:𓈖:° |     | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤 |    | |
| 𓏌:𓈖:°𓏤𓉐𓏤@1 |  | |
| 𓏌:𓈖𓏤1𓉐𓏤@1 |    | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤 |      | |
| 𓏌:𓈖𓏤𓉐𓏤@1 |       | |
| 𓏌:𓏤 |  | |
| 𓏌𓏲1 | 𓏌𓏲 |                       |
| 𓏌𓏲2 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏌𓏲𓍖:𓏛 | 𓏌𓏲 |  |
| 𓏎:𓈖 |           | |
| 𓏎:𓈖:° |  | |
| 𓏎:𓈖𓏤 |       | |
| 𓏏 | 𓏏 |                                                                                                     |
| 𓏏*𓏤 | 𓏏𓏤 |        |
| 𓏏*𓏰 | 𓏏𓏰 |         |
| 𓏏1 | 𓏏 |                           |
| 𓏏1:° | 𓏏 |  |
| 𓏏:° | 𓏏 |   |
| 𓏏:𓄿 |                                                                                 | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋 |      | |
| 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓅱:𓎡 |     | |
| 𓏏:𓄿𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑 |      | |
| 𓏏:𓄿𓏭 |           | |
| 𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥 |   | |
| 𓏏:𓆇 |         | |
| 𓏏:𓆇1 |    | |
| 𓏏:𓆑 |    | |
| 𓏏:𓈇𓏤@1 |  | |
| 𓏏:𓈖:𓏥 |   | |
| 𓏏:𓈖:𓏥:° |    | |
| 𓏏:𓈙 |     | |
| 𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖1 |  | |
| 𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖3 |    | |
| 𓏏:𓏭 |   | |
| 𓏛 | 𓏛 |    |
| 𓏛:𓏫:° |     | |
| 𓏛𓏏 | 𓏛𓏏 |  |
| 𓏞𓍼:𓏤 | 𓏞 |    |
| 𓏞𓍼:𓏤@ | 𓏞 |         |
| 𓏠:𓈖 |            | |
| 𓏠:𓈖1 |   | |
| 𓏠:𓈖1:° |   | |
| 𓏠:𓈖1:°𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |   | |
| 𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛 |  | |
| 𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |  | |
| 𓏠:𓈖𓈖2:𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤 |  | |
| 𓏠:𓈖𓐍:𓍊𓏤 |  | |
| 𓏤 | 𓏤 |                                                          |
| 𓏤1 | 𓏤 |     |
| 𓏤1𓈘:𓈇 | 𓏤 |  |
| 𓏤𓊖 | 𓏤𓊖 |    |
| 𓏤𓏛:𓏫:° | 𓏤 |  |
| 𓏤𓏰:𓇳5 | 𓏤 |           |
| 𓏤𓏰:𓊖1 | 𓏤 |        |
| 𓏤𓏰:𓊖3 | 𓏤 |                          |
| 𓏥 | 𓏥 |       |
| 𓏪 | 𓏪 |                                                                                                                                                                             |
| 𓏪1 | 𓏪 |                                                                                                       |
| 𓏪1° | 𓏪 |    |
| 𓏪3 | 𓏪 |                                       |
| 𓏫 | 𓏫 |       |
| 𓏫1:° | 𓏫 |   |
| 𓏫:° | 𓏫 |       |
| 𓏭 | 𓏭 |   |
| 𓏭:𓂢 |     | |
| 𓏭:𓏛 |                                                    | |
| 𓏭:𓏛1 |                                 | |
| 𓏰:𓀀 |   | |
| 𓏰:𓀀𓀁 |  | |
| 𓏰:𓇳1 |                    | |
| 𓏰:𓇳1@ |           | |
| 𓏰:𓇳2𓏤2 |            | |
| 𓏰:𓇳𓏤3 |  | |
| 𓏰:𓊖2° |    | |
| 𓏰:𓏛 |  | |
| 𓏲 | 𓏲 |                       |
| 𓏲1 | 𓏲 |        |
| 𓏲2 | 𓏲 |   |
| 𓏲:𓏏 |                            | |
| 𓏲:𓏏𓏤 |         | |
| 𓏲𓏭:𓏛 | 𓏲 |                                                            |
| 𓏴:𓂡 |              | |
| 𓏴:𓂡1 |  | |
| 𓏴:𓂡𓍘1 |         | |
| 𓏴:𓏛4 |   | |
| 𓏴:𓏛4𓀁 |   | |
| 𓏶 | 𓏶 |        |
| 𓏶𓅓 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓1 | 𓏶𓅓 |  |
| 𓏶𓅓1:𓏭 | 𓏶 |   |
| 𓏶𓅓𓏭 | 𓏶𓅓𓏭 |    |
| 𓏺 | 𓏺 |      |
| 𓏺:𓏏 |      | |
| 𓏻 | 𓏻 |   |
| 𓏻4 | 𓏻 |  |
| 𓏻:𓏌 |   | |
| 𓏼1 | 𓏼 |              |
| 𓏽1 | 𓏽 |   |
| 𓏾 | 𓏾 |      |
| 𓏾2 | 𓏾 |  |
| 𓏿 | 𓏿 |        |
| 𓐀 | 𓐀 |       |
| 𓐀1 | 𓐀 |  |
| 𓐁 | 𓐁 |     |
| 𓐁1 | 𓐁 |   |
| 𓐁1:𓐋2𓏌𓏲1𓀼 |   | |
| 𓐁:° | 𓐁 |  |
| 𓐂 | 𓐂 |    |
| 𓐅 | 𓐅 |  |
| 𓐆 | 𓐆 |  |
| 𓐇 | 𓐇 |  |
| 𓐈1 | 𓐈 |  |
| 𓐉 | 𓐉 |  |
| 𓐊 | 𓐊 |   |
| 𓐋2 | 𓐋 |   |
| 𓐍 | 𓐍 |                   |
| 𓐍:𓂋 |       | |
| 𓐍:𓂋𓀁 |       | |
| 𓐍:𓅓 |     | |
| 𓐍:𓅓𓅪 |  | |
| 𓐍:𓅓𓅪:° |    | |
| 𓐍:𓊪2 |   | |
| 𓐍:𓏏*𓏰 |     | |
| 𓐍:𓏭 |            | |
| 𓐎 | 𓐎 |  |
| 𓐑:𓊪 |       | |
| 𓐑:𓊪1 |  | |
| 𓐑:𓊪𓏲1 |  | |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛 | 𓐠𓏤 |                 |
| 𓐠𓏤𓏰:𓏛1 | 𓐠𓏤 |                            |
| 𓐪 | 𓐪 |    |
| 𓐪𓂧:𓏏*𓏰 | 𓐪 |   |
| 𓐪𓏏:𓊌 | 𓐪 |  |
| | |  |
| | |         |
| ⸗y "[Suffixpron. 1. sg. c.]" |               |
| ⸗w; [⸗w]; ⸢⸗w⸣; [[⸗w]]; ⸢⸗w(?)⸣ "[Suffixpron. 3. pl. c.]" |                                                                                                                                                                           |
| ⸗f; [⸗f]; ⸢⸗f⸣ "[Suffixpron. 3. sg. m.]" |                                                                                                                                                             |
| ⸗n "[Suffixpron. 1. pl. c.]" |   |
| ⸗s; ⸢⸗s⸣; {⸗s} "[Suffixpron. 3. sg. f.]" |                                                 |
| ⸗k "[Suffixpron. 2. sg. m.]" | 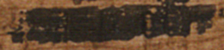       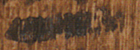 |
| ⸗tn "[Suffixpron. 2. pl. c.]" |     |
| ꜣwy "Lobpreis" |  |
| ꜣbḫ "vergessen" |  |
| ꜣbd "Monat" |   |
| ꜣbd-1 "Monat 1" |   |
| ꜣbd-2 "Monat 2" |     |
| ꜣbd-3; ⸢ꜣbd-3⸣ "Monat 3" |        |
| ꜣbd-4 "Monat 4" |   |
| ꜣbdy "Neulicht, zweiter Tag des Mondmonats" |   |
| ꜣfꜥ(.t); ꜣfꜥ(.w) "gierig [Adjektiv]" |   |
| ꜣrwy "Stengel, Stoppel, Spreu" |   |
| ꜣlly "Weinstock, Rebe" |  |
| ꜣḥ.w "Acker" |  |
| ꜣḫ(.t) "Überschwemmungsjahreszeit, Achet" |     |
| ꜣs(.t) "Isis [GN]" |   |
| ⸢ꜣsy⸣ "leicht sein" |  |
| ꜣsḳ "zögern" | 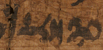 |
| ꜣḳ(?) "zugrunde gehen, zerstört werden" |  |
| ꜣgy "tüchtig, vorzüglich, vortrefflich" | 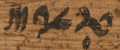 |
| ⸢ꜣt⸣y.t(?) "Leib, Bauch" |  |
| ⸢ꜣtḥ(.w)⸣ "Bündel" |  |
| ꜣḏꜣ(.t) "Hacke" | 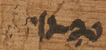 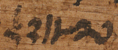 |
| ỉ "o" |  |
| ỉ.ỉr-ḥr; ỉ:ỉr-ḥr "vor, bei, zur Zeit von [Präp.]" |      |
| ỉ.ḳd "Baumeister" |  |
| ỉꜣw.t "Amt, Würde" |    |
| ỉꜣw.t-(n)-ḥrỉ "Herrscheramt" |    |
| ỉꜣb.tỉ "Osten" |  |
| ỉ:ỉri̯ "[Konverter 2. Tempus]" |      |
| ỉ:ỉri̯; (ỉ:)ỉri̯; ⸢ỉ:ỉri̯⸣ "[Bildungselement des Partizips]" |                  |
| ỉ:ỉri̯⸗f "[Konverter 2. Tempus + Suffixpron. 3. sg. m.]" | 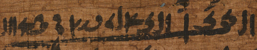   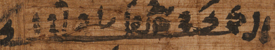      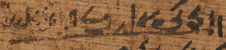 |
| ỉyi̯ "kommen" |            |
| ỉꜥḥ "Mond" |  |
| Ỉꜥḥ-ms; 𓍹Ỉꜥḥ-ms; 𓍹Ỉꜥḥ-ms ꜥ.w.s; Ỉꜥḥ-ms ꜥ.w.s "Amasis [KN]" |        |
| ỉw; [ỉw] "[Bildungselement des Futur III]" |                                                            |
| ⸢ỉw⸗w⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. pl. c.]" |   |
| ỉw⸗f "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. m.]" |          |
| ỉw⸗f "wenn er [Konditionalis + Suffixpron. 3. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗f; ⸢ỉw⸗f⸣ "er [proklit. Pron. 3. sg. m.]" |        |
| ỉw⸗f; ỉw⸗f(?) "indem er [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |             |
| ỉw⸗s "sie [proklit. Pron. 3. sg. f.]" |       |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣ "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. f.]" |       |
| ỉw⸗s; ⸢ỉw⸗s⸣; ⸢ỉw⸣⸗s "indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. f.]" |             |
| ỉw⸗k "du [proklit. Pron. 2. sg. m.]" |   |
| ỉw⸗k "indem du [Umstandskonverter + Suffixpron. 2. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗k "[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 2. sg. m.]" |    |
| ỉw⸗k "[Konditionalis + Suffixpron. 2. sg. m.]" |  |
| ỉwi̯; ỉwi̯.w "kommen" |    |
| ỉwỉw.w; ỉwỉw "Hund" |   |
| ỉwn "Schiffsfahrt " |  |
| Ỉwnw "Heliopolis [ON])" | 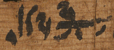 |
| ỉwr "schwanger werden" |  |
| ỉb "Herz" |  |
| ỉbỉ "Honig" |   |
| ỉp "zählen" |     |
| ỉpe.t; ỉpe(.t); ỉp(.t) "Arbeit" |         |
| ỉpre "Sproß, Samen, Korn" |  |
| ỉpt "Tafel" |  |
| ỉpd.w; ỉpd; ỉpd(.w) "Geflügel, Gans, Vogel" |    |
| ỉmn "Amun [GN]" |   |
| ỉmn.tỉ "Westen" |  |
| Ỉmn-ỉ:ỉri̯-ḏi̯.t-s "Amyrtaios [KN]" | 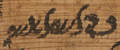  |
| ỉn "[Fragepartikel]" |     |
| ỉn; ⸢ỉn⸣ "[Postnegation]" |      |
| ỉn.ḳdy "schlafen" |  |
| ỉn-nꜣ.w "wenn [Bildungselement Konditionalis]" |  |
| ỉni̯ "holen, bringen" |         |
| ỉne "Stein" |    |
| ỉr.t "Auge" |   |
| ỉrỉ "Gefährte" |  |
| ỉri̯; {ỉri̯}; ỉri̯ (?); ỉ:ỉri̯; ⸢ỉri̯⸣ "tun, machen" |                                                            |
| ỉri̯⸗f; ⸢ỉri̯⸗f(?)⸣ "[Verb + Suffixpron. 3. sg. masc.]" |      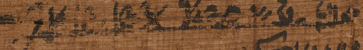    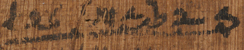   |
| ỉri̯-ỉp(.t) "Geschäft" |  |
| ỉri̯-ḥrỉ "Herrschaft, Regierung" |        |
| ỉri̯-sh̭y "Macht haben über, verfügen über" |  |
| ỉrp "Wein" |   |
| ỉrpy; ỉrp⸢y⸣.w; ỉrpy.w; ỉrpꜣ; ỉrpꜣ.w; ⸢ỉrpꜣ⸣.w; ỉrpꜣ(.w); ⸢ỉrp⸣ "Tempel" |                 |
| ỉrm; ⸢ỉrm⸣ "mit, und [Präp.]" |          |
| ỉrm pꜣ ḫpr ꜥn "und ferner" | 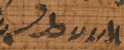 |
| ỉḥ.w "Rind" |   |
| ỉḥ.t "Kuh" |  |
| ỉḫ "was?, wer?" |  |
| ỉšr "Syrer, Assyrer" |  |
| ỉṱ "Vater" |    |
| ỉt "Gerste" |  |
| yꜥbꜣ(.t); yꜥb⸢ꜣ(.t)⸣ "Krankheit" |    |
| yꜥr "Fluß, Kanal" | 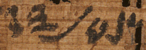  |
| yꜥr-ꜥꜣ "'großer Fluß', Nil" | 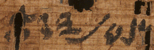 |
| Ybyꜣ "Elephantine [ON]" | 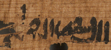 |
| ys "eilen" |  |
| [ꜥ].wỉ; ꜥwỉ.w; ꜥ.wỉ "Haus, Platz" |      |
| ꜥ.wỉ-(n)-wpy "Haus des Richtens, Gericht" |  |
| ꜥꜣ; ꜥ[ꜣ](?) "Art, Zustand" |      |
| ꜥꜣ; ꜥy.w; ⸢ꜥy.w⸣; ⸢ꜥꜣ⸣ "groß [Adjektiv]" |           |
| ⸢ꜥy.w-(n)-ms⸣ "alt sein, alt werden" |  |
| ꜥw; ꜥꜣ; ꜥy "groß sein [Adjektivverb]" |     |
| ꜥw-n-ỉr.t "Glück" |  |
| ꜥby.t "Spende, Opfer" | 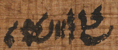 |
| ꜥn; ⸢ꜥn⸣ "erneut, wieder [Adverb]" |         |
| ⸢ꜥ⸣nn "[e. Vogel]" |  |
| ꜥnḫ "leben" |     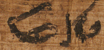  |
| ꜥnḫ "Leben" |  |
| ꜥnḫ.t "Anches [PN]" |  |
| ꜥrꜥy(.t); ꜥry(.t) "Uräusschlange" |        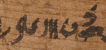 |
| ꜥrwy "vielleicht [Adv.]" | 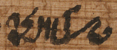 |
| ꜥrḳy "letzter Monatstag" |      |
| ꜥrḏ "Sicherheit, Festigkeit" |  |
| ꜥḥꜥ "stehen" |     |
| ꜥḫ "Feuerbecken, Ofen" |    |
| ꜥš "rufen" |      |
| ꜥš-šlly "flehen" |  |
| ꜥšꜣ "zahlreich sein [Adjektivverb]" |     |
| ꜥšꜣ "zahlreich [Adjektiv]" |  |
| ꜥḳ "Brot, Ration" |     |
| ꜥt.w(t); ꜥty(.t) "Körperteil, Glied" |   |
| wꜣḥ "Antwort" |  |
| wꜣḥ-sḥn "befehlen" |  |
| wyꜥ "Bauer" | 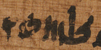 |
| Wynn.w; Wynn(.w) "Grieche" |   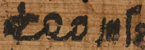 |
| ⸢wꜥ(?)⸣ sp-2; wꜥ sp-2 "einer nach dem anderen" |   |
| wꜥ.t; wꜥ; ⸢wꜥ⸣; ⸢wꜥ(?)⸣ "eine" |                  |
| wꜥꜣ "Weh!" |  |
| wꜥb "Reinheit; Reinigung" |  |
| wꜥb; wꜥb.w "Priester" |          |
| wꜥb.w; wꜥb "rein sein, unbelastet sein" |          |
| wꜥb.t "Balsamierung, Tod" |  |
| wbꜣ "gegenüber [Präp.]" |  |
| wpy "öffnen, trennen, richten" |  |
| wn "öffnen" |            |
| wn "sein, existieren" |       |
| Wn-h̭m "Wenchem [ON]" |  |
| wnm "rechts, rechte Seite" |    |
| wnm "essen" |        |
| wnty.w "Kurzhornrind, Opfertier " |  |
| wr<š>e "Altlicht; Mondmonat" |   |
| whꜥ "böse Tat, Sünde, Verfehlung" |  |
| Wsr⸢kn⸣(?) "Osorkon [PN]" |  |
| wṱ "Befehl, Erlass, Dekret" |  |
| wḏꜣ "unversehrt sein" |  |
| b⸢ꜣ⸣(.t) "Busch" |  |
| bỉk.w "Falke" |  |
| bw-ỉri̯; ⸢bw⸣-ỉri̯ "[Negation des Aorists]" |          |
| bw-ỉri̯-tw "noch nicht [neg. Perfekt]" |  |
| bn "[Negation]" |  |
| bn "böse, schlecht, schlimm [Adjektiv]" |  |
| bn.ỉw "[Negation Futur III]" |     |
| bn.ỉw "[Negation Präsens I]" |     |
| bn-p "[Negation Vergangenheit]" |                        |
| bnr "Außen, Außenseite" |  |
| blꜣ "lösen" |  |
| bš "entblößen, verlassen, reduzieren" |  |
| bgs "sich empören, rebellieren" |  |
| btw "Strafe" | 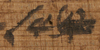    |
| bd(.t) "Emmer" |   |
| p.t; p(.t) "Himmel" |   |
| pꜣ; ⸢pꜣ⸣ "der [def. Art. sg. m.]" |                                                                                                                                                                                 |
| pꜣ tꜣ (n) rsỉ "Südland" |  |
| pꜣ tꜣ (n) ẖr "Syrerland, Syrien [ON]" |   |
| pꜣ-bnr-n; pꜣ-bnr-(n) "außer, außerhalb [Präp.]" |   |
| pꜣ-hrw "heute, jetzt [Adverb]" |     |
| Pꜣ-s-n-mṯk(?) "Psammetich [PN]" |  |
| Pꜣ-s-n-[mṯk](?) "Psammetich [KN]" |  |
| Pꜣ-šrỉ-Mw.t "Psammuthis [KN]" |  |
| ⸢Pꜣ⸣-di̯-ꜣs(.t) "Peteesis [PN]" |  |
| pꜣỉ "[def. Art. sg. m. + Präfix der Relativform]" |   |
| pꜣỉ "dieser [Demonstrat. sg. m.]" |  |
| pꜣỉ; ⸢pꜣỉ⸣ "[Kopula sg. m.]" |                                       |
| pꜣy⸗ỉ "mein" |  |
| pꜣy⸗w "ihr" |      |
| pꜣy⸗f; ⸢pꜣy⸗f⸣ "sein" |                                  |
| pꜣy⸗n "unser" |    |
| pꜣy⸗k "dein" |  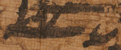   |
| ⸢pa⸣; pa "der von" |       |
| Py "Pe, Buto [ON]" | 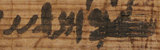  |
| py "Thron" |  |
| pr "der [def. Artikel sg. m., v.a. bei Himmelsrichtungen]" |  |
| pr.w; pr "Haus" |   |
| pr(.t) "Aussaat-Zeit, Peret, Winter" |       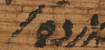     |
| pr-ꜥꜣ; ⸢pr-ꜥꜣ⸣ "König" |             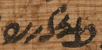                                  |
| pr-pr-ꜥꜣ "Königspalast" |  |
| Pr-nb(.t)-ṱp-ỉḥ "Aphroditopolis, Atfih [ON]" | 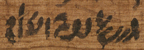 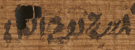 |
| pri̯ "herauskommen" |  |
| prt.w; prt "Saatgut, Getreide" |   |
| prḏꜣ "Kinn(?)" | 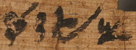 |
| pḥ "erreichen, ankommen" |       |
| pḥ[.ṱ] "Kraft, Ehre" |  |
| pẖrꜣ "herumgehen, durchziehen" | 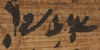 |
| pẖry.w(t); pẖry(.t) "Medikament, Zaubermittel" |    |
| psy "kochen, backen" |  |
| pš.t "Hälfte" |  |
| Ptḥ "Ptah [GN]" |    |
| fy "tragen" |  |
| fy "Trägerin" |  |
| fnṱ(?) "Nase" |  |
| m-ỉri̯ "[Negierung des Imperativs]" |     |
| m-bꜣḥ "vor (Gott oder König) [Präp.]" |   |
| m-sꜣ; m-sꜣ⸗ "hinter [Präp.]" |                            |
| m-sꜣ-ḫpr "aber, jedoch" |  |
| m-šs; ⸢m-šs⸣ "sehr [Adverb]" |      |
| m-ḳdy; ⸢m⸣-ḳdy; m-ḳde "in der Art von [Präp.]" |    |
| m-tw⸗ "durch [Präp.]" |  |
| m-tw⸗; m-tw "bei, jemanden gehören [Präp.]" |       |
| m-ḏr; (n)-ḏr.ṱ⸗; (n)-ḏr.ṱ; (n)-ḏr(.t) "bei, durch [Präp.]" |   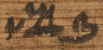      |
| mꜣỉ.w(t); mꜣy(.t) "Insel" |   |
| mꜣꜥ.w; mꜣꜥ "Ort, Platz" |    |
| mꜣḫe.t; mꜣḫe(.t) "Waage" |   |
| mỉ(.t); mỉ.t "Straße" |  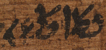 |
| my "[enklitische Partikel nach dem Imperativ]" |  |
| my; ⸢m⸣y; ⸢my⸣; me "[Imperativ von ḏi̯.t]" |    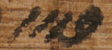     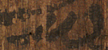 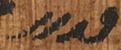  |
| myt "Weg, Rechtsanspruch" |   |
| mꜥḏy "Profit" | 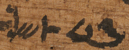  |
| mw "Wasser" |     |
| Mw(.t) "Mut [GN]" |     |
| mwt "Tod" |  |
| ⸢mwt⸣; mwt "sterben" |   |
| mn; bn.ỉw "es gibt nicht [Negation der Existenz]" |        |
| [Mn]-nfr; Mn-nfr "Memphis [ON]" |    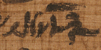 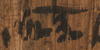 |
| mne "täglich [Adverb]" | 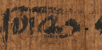 |
| mnḫ "tugendhaft, wohltätig sein [Adjektivverb]" | 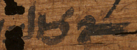   |
| mnḫ "Wohltat, gute Tat" |  |
| mnḫ(.wt) "Kleider" |  |
| mnḳ "Vollendung" |    |
| mnḳ "vollenden" |   |
| mr.t "Liebe, Beliebtheit, Wunsch, Wille" |   |
| mri̯; mri̯.ṱ⸗ "lieben, wünschen" |       |
| mlẖ "Streit" |  |
| mḥ "füllen" |          |
| mḥ-10.t "zehntes" |  |
| mḥ-11 "elftes" |  |
| mḥ-12 "zwölftes" |  |
| mḥ-13 "dreizehntes" |  |
| [mḥ-14] "vierzehntes" | |
| mḥ-2 "zweiter" |      |
| mḥ-3 "dritter" |      |
| mḥ-4 "vierter" |    |
| mḥ-5 "fünfter" |    |
| mḥ-6 "sechster" |    |
| mḥ-7.t; mḥ-7 "siebtes" |    |
| mḥ-8.t "achtes" |  |
| mḥ-9.t "neuntes" | 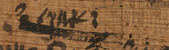 |
| mḥe.w "Flachs" |  |
| mḥtỉ "Norden" |  |
| mh̭y "gleichen, vergleichen" |  |
| mh̭y; [m]h̭y; mh̭⸢y⸣ "schlagen" |    |
| ms.t; ⸢ms⸣ "Geburt" | 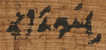  |
| msḥ.w "Krokodil" | 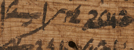 |
| mšꜥ "Armee, Volksgruppe, Menge" |    |
| mšꜥ "gehen, marschieren" |   |
| mtỉ "Flut, Wasser" | 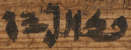 |
| mtỉ.t "Mitte" |  |
| mtw "[Bildungselement des Konjunktivs]" |         |
| mtw⸗s "[selbst. Pron. 3. Sg. f.]" |  |
| mtr "Zeuge sein, zugegen sein" |  |
| mtry(.t) "Mittag" |  |
| md.w(t); md(.t); ⸢md(.t)⸣; md.t; ⸢md.t⸣ "Rede, Wort, Sache, Angelegenheit" |             |
| Mdy.w; Mdy⸢.w⸣; Mdy(.w) "Meder, Perser" | 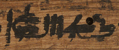 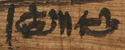          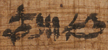 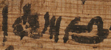  |
| n; ⸢n⸣; [n] "des [Genitiv]" |                     |
| n; n.ỉm⸗; ⸢n.ỉm⸗⸣; {r} <n> "in (< m) [Präp.]" |                                                                             |
| n; n⸗ "zu, für (< n; Dativ)" |                               |
| n.ỉm; n.ỉm⸗w "dort [Adverb]" |    |
| n.n⸗w; ⸢n.n⸗w⸣ "für sie" |                      |
| n.n⸗s "für sie" |  |
| N(.t) "Neith [GN]" |  |
| n⸗k "für dich" |  |
| (n)-wꜥ-sp "alle zusammen" |  |
| (n)-bnr "außen, draußen [Adverb]" |  |
| (n)-pꜣ-s-2 "die zwei Personen, die beiden" |  |
| (n)-rn; (n)-rn⸗; ⸢(n)-rn⸣; (n-)rn "besagter, betreffender" |          |
| (n)-tꜣ-ḥꜣ.t "früher, vorne [Adverb]" |       |
| (n)-ṯꜣi̯-(n) "von ... an, seit [Präp.]" |  |
| n-ḏr(.t) "als, nachdem [Temporalis]" |        |
| nꜣ; ⸢nꜣ⸣ "die [def. Art. pl. c.]" |                                                                                                                               |
| nꜣ.w "[def. Art. pl. c. + Präfix der Relativform]" |      |
| nꜣ.w "[Kopula Plural]" |       |
| nꜣ.w; n⸗ỉ "für mich" |   |
| nꜣ.w-wn-nꜣ.w "[def. Artikel pl. c. + Präfix der Relativform + Imperfektkonverter]" |  |
| nꜣ-ꜥn; ꜥn "schön sein [Adjektivverb]" |      |
| nꜣ-nḫṱ "stark sein [Adjektivverb]" | 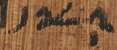 |
| nꜣ-nḏm; nḏm "angenehm sein, froh sein [Adjektivverb]" |   |
| nꜣy "diese [Demonstrat. pl. c.]" |     |
| nꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| nꜣy⸗w "ihre" |               |
| nꜣy⸗f "seine" |         |
| Nꜣy⸗f-ꜥw-rd.wỉ "Nepherites [KN]" |  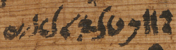 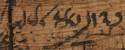 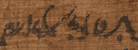  |
| nꜣy⸗n "unsere" |   |
| nꜣy⸗s "ihre" |  |
| nꜣy⸗k "deine" |  |
| nw "Zeit" |   |
| nw; ỉ:nw "sehen" |       |
| nwḥ; ỉn.nwḥ "Strick" |     |
| nb "Gold" |   |
| ⸢nb⸣ "jeder; irgendein" |  |
| nb; nb.w; ⸢nb⸣ "Herr" |        |
| nb.t "Frevel, Sünde" |  |
| nb(.t); nb.t "Herrin" |   |
| nb-n-ḫꜥi̯ "Herr der Erscheinungen" |  |
| nf "Segler" |   |
| nfr "gut sein [Adjektivverb]" |   |
| nfr "gut [Adjektiv]" |  |
| nmꜣy(.t)(?) "'Wanderin' (?)" |   |
| nhe(.t) "Sykomore" |  |
| nḫ(?)(.t) "Klage, Totenklage" | 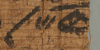 |
| nḫby(.t) "Königstitulatur" | 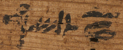 |
| Nḫṱ-nb⸗f "Nektanebos I. [KN]" |  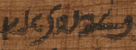 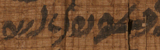 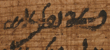     |
| nsw "König" |  |
| nk "Geschlechtsverkehr haben" |  |
| nkt "Sache" |        |
| nkt-ḥwrꜥ "Raubgut" |  |
| ntỉ; ⸢ntỉ⸣ "[Relativkonverter]" |                                                                       |
| ntỉ.ỉw; mtw "[Relativkonverter]" |                       |
| ntỉ.ỉw⸗f "[Relativkonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]" |  |
| ntỉ.ỉw⸗k "[Relativkonverter + Suffixpron. 2 sg. m.]" |  |
| ntỉ-ỉri̯ "[Relativkonverter + r im Futur III vor nominalem Subjekt]" |  |
| ntỉ-wꜥb "Sanktuar" |     |
| nṯr "Gott" |      |
| nṯr.w; nṯr⸢.w⸣; ⸢nṯr.w⸣ "Götter" |                |
| r "[im Futur III vor nominalem Subjekt]" |       |
| r "[im Futur III vor Infinitiv]" |            |
| r "macht (bei Beträgen u.ä.)" |     |
| r; ỉw; ⸢ỉw⸣ "indem, wobei [Umstandskonverter]" |                        |
| r; [r]; r.ḥr⸗ "zu, hin [Präp.]" |                                                |
| r.r⸗w "zu ihnen" |     |
| ⸢r⸣.r⸗f "zu ihm" |  |
| r.r⸗s "zu ihr" |  |
| r.r⸗k "zu dir" |   |
| r-wbꜣ "gegen, gegenüber, vor [Präp.]" |     |
| r-bw.nꜣỉ "hierher [Adverb]" |  |
| r-bnr "heraus [Adverb]" |  |
| r-hn "bis hin zu [Präp.]" |   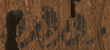 |
| r-ḥr "auf, vor [Präp.]" |    |
| r-ẖ(.t) "in der Art von, entsprechend [Präp.]" |      |
| r-ẖn "hinein in [Präp.]" | 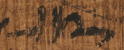 |
| (r)-šw "überhaupt; wieder, jemals" |  |
| (r)-ḏbꜣ; (r)-ḏbꜣ⸗; ⸢(r)-ḏbꜣ⸣; (r-)ḏbꜣ; (r-)ḏbꜣ.ṱ⸗ "wegen [Präp.]" | 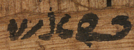    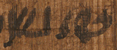  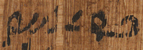     |
| Rꜥ "Re [GN]" |      |
| r:wn-nꜣ.w-⸢ỉw⸗⸣; (r:)wn-nꜣ.w; wn-nꜣ.w; ⸢wn-nꜣ⸣.w; ⸢wn⸣-nꜣ.w; wn-⸢nꜣ.w⸣ "[Präfix der Relativform + Imperfektkonverter]" |              |
| rmy "weinen, beweinen" | 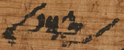  |
| rmy(.t) "Träne" |  |
| rmṯ; rmṯ.w; ⸢rmṯ⸣ "Mensch, Mann" |                   |
| rmṯ.w-ꜥy.w "reicher, vornehmer Mann" | 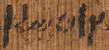 |
| rmṯ.w-rḫ.w; rmṯ-rḫ "Gelehrter" |   |
| rmṯ-(n)-ḳnḳn; rmṯ.w-(n)-ḳnḳn "Krieger" |   |
| ⸢rmṯ⸣(?)-n-Km "Ägypter" |  |
| rn "Name" |        |
| rnp(.t); rnp.w(t) "Jahr" |           |
| rḫ; ỉr.rḫ; ⸢rḫ⸣ "wissen, können" |               |
| rsỉ "Süden" |  |
| rsṱy "Morgen" |   |
| rše; ršy "sich freuen" | 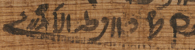  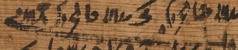  |
| ršy "Freude" |  |
| (r:)ḳd "bauen" |  |
| rd.wỉ "Fuß" |  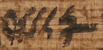  |
| lk "aufhören, beseitigen" |        |
| <mḥ-1>; mḥ-1 "erster" |   |
| <3.nw> "dritter" | |
| hꜣ; ⸢h⸣[ꜣ] "Zeit" |                 |
| hwš "schmähen, kränken" |  |
| hb "senden, schicken" |  |
| ⸢hp⸣; hp "Recht, Gesetz, Gesetzanspruch" |              |
| hri̯.w "zufrieden sein, besänftigt sein" |  |
| hrw "Tag" |    |
| Hgr; Hḳr "Hakoris [KN]" |  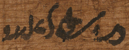 |
| htmꜣ "Thron" |  |
| ḥꜣ(.t) "vor [Präp.]" |   |
| ḥꜣ.t; ḥꜣ(.t) "Vorderteil, Anfang, Spitze" |     |
| ḥꜣ.tỉ; ḥꜣ.tỉ⸗ "Herz" |        |
| ḥꜣṱ; ḥꜣṱ.t "erster, früherer [Adjektiv]" |   |
| ḥꜥ⸗ "selbst" |   |
| ḥw; ḥw.w "Vermehrung, Profit" |   |
| ḥw.ṱ "Ackerbauer" |  |
| Ḥw.t-nn-nsw; Ḥw.t-(nn)-nsw "Herakleopolis [ON]" |    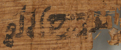   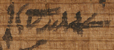   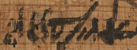 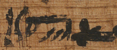 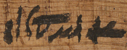 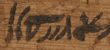  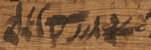  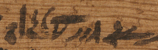 |
| ḥw(.t)-nṯr "Tempel" |    |
| ḥwe(.t); ḥwe.t; ⸢ḥwe⸣[.t] "Kapitel, Strophe" |         |
| ḥwy "Regen" |   |
| ḥwy "schlagen, werfen" |     |
| ḥwrꜥ "rauben, berauben" |   |
| ḥwrꜥ; ḥwrꜥ(.w) "Raub, Räuberei" |    |
| ḥwṱ "Mann, männlich" |  |
| ḥbs "bekleiden, bedecken" | 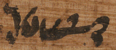 |
| ḥbs.w "Kleidung" |  |
| Ḥp "Apisstier [GN]" |         |
| ḥm.t "Frau, Ehefrau" |    |
| ḥm-nṯr; ⸢ḥm-nṯr(?)⸣ "Gottesdiener, Prophet" |     |
| ḥmꜣ.t "Gebärmutter" |   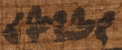 |
| ḥn; (r:)ḥn "befehlen" |           |
| ḥnꜥ "und, zusammen mit, oder [Präp.]" |  |
| ḥr "auf [Präp.]" |               |
| ḥr "Gesicht" |  |
| ḥr-ꜣt⸗; ḥr-ꜣt.ṱ "auf [Präp.]" | 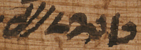 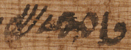  |
| Ḥr-mꜣꜥ-ḫrw "Harmachoros [PN]" |  |
| Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) "Horus, Sohn der Isis [GN]" |    |
| Ḥr-šf "Herischef [GN]" |      |
| ḥrỉ "oben [Adverb]" |       |
| ḥrỉ "Oberster, Herr, Vorgesetzter" |                                           |
| ḥrḥ "wachen, hüten" |  |
| ḥlly; ḥll "Trübung, Finsternis (?)" | 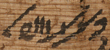  |
| ḥsb(.t); ⸢ḥsb(.t)⸣ "Regierungsjahr" |      |
| ḥḳr; ḥḳꜣ "hungern" |     |
| ḥtp-nṯr "Gottesopfer" |  |
| ḥḏ; ḥḏ.w "Silber, Geld" |    |
| ḥḏ.t "Weiße Krone" |  |
| ḫꜣ "Meßstab" |   |
| ḫꜣꜥ; ḫꜣꜥ(?) "werfen, legen, lassen, verlassen" |           |
| ḫꜣsy(.t); ḫꜣs.w(t); ḫꜣs(.wt) "Fremdland, Wüste, Nekropole" |        |
| h̭yh̭e "Staub" |  |
| ḫꜥ "Fest" |  |
| ḫꜥi̯ "erscheinen" |     |
| h̭wy "Weihrauch" |  |
| ḫby "vermindern, abschneiden, rasieren" |  |
| ḫpr "geschehen" |                                                             |
| ḫpr "es ist so (dass), denn, weil [Konjunktion]" |        |
| ḫpš; ḫbš "Sichelschwert" |    |
| ḫm.w; ḫm "klein, jung [Adjektiv]" |    |
| ḫm-ẖr.w; ḫm-ẖr(.w) "Knabe, junger Mensch, Bursche, Kind" | 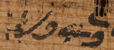 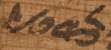   |
| Ḫmnw "Hermopolis [ON]" |  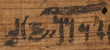 |
| ḫnms "Mücke" |  |
| ḫnṱ "stromauf fahren" |   |
| ḫr "[Präfix des Aorists]" |       |
| ḫrw "Stimme" |   |
| ḫsf "verachten, tadeln" |  |
| ḫštrpn "Satrap" | 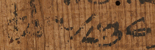 |
| ḫt(.w); ḫt "Holz, Bäume" |       |
| ẖ(.t) "Kopie, Abschrift, Wortlaut" |  |
| ẖ(.t); ẖ.w(t) "Leib, Körper" |   |
| ẖꜣ(.t) "Gemetzel" |     |
| ẖꜥ.t "Ende" |  |
| ẖn "sich nähern" |  |
| ẖn; ẖn⸗ "in [Präp.]" | 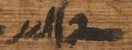       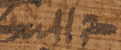          |
| H̱nm "Chnum [GN]" | 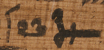  |
| ẖr "Syrer" |   |
| ẖr; ẖr.r.ḥr⸗ "unter, wegen [Präp.]" |    |
| ẖr.t "Speise, Nahrung" |  |
| ẖr-nṯr "Steinmetz" |   |
| ẖr-⸢hrw(?)⸣ "täglich" |  |
| ẖrꜣ(.t) "Gewand, Riemen" | 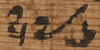 |
| ẖre.w(t) "Gasse" |  |
| ẖry.w; ẖry "Straße, Weg" |  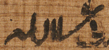 |
| ẖry.t "Witwe" |  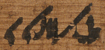 |
| ẖr⸢m⸣y "[e. Vogel]" |  |
| ẖrd.w "Kinder" |  |
| ẖl "Knabe, Diener" |  |
| s "Mann, Person" |  |
| s; st; ⸢s⸣ "[enklit. Pron. 3. sg. m.]" |                                   |
| s.t "Platz, Ort" |  |
| sꜣ "Phyle" |    |
| sꜣ "Sohn" |  |
| sỉ-n-ꜥḳ "Bäcker" |   |
| sꜥnḫ "ernähren, leben lassen" |  |
| sw "Monatstag" |            |
| sw-10 "Dekade" |    |
| swr "trinken" |       |
| sbꜣ.w "Tür" |   |
| sby "Lachen, Gelächter" |  |
| sby "lachen" |  |
| sbḳ(.w) "klein, gering [Adjektiv]" |  |
| sbt "herrichten, ausrüsten, vorbereiten, versorgen" |  |
| sp "Rest" |     |
| sp "Fall, Angelegenheit, Mal" |   |
| sp-2 "zweimal [Wiederholungszeichen]" |        |
| sf "gestern [Adverb]" |   |
| s[fy] "Messer, Schwert" |  |
| smn "aufsetzen, feststellen, dauern (lassen)" |  |
| smḥ (?) "links" |    |
| smt; [s]mt "Art, Weise, Gestalt" |      |
| sn.w "Bruder" |  |
| ⸢s⸣nty "sich fürchten" |  |
| sr "verkünden, anzeigen, prophezeien" |  |
| sr.w "Fürst, Beamtenschaft, Kollegium" | 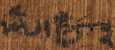   |
| s(?)rꜣ.w(t) "Dorn, Stachel" |  |
| sḥm.t; sḥm.w(t) "Frau" |      |
| sḥn "Krone, Diadem" |   |
| sḥn; ⸢sḥn⸣.y "Angelegenheit, Amt, Befehl, Auftrag" |   |
| sḥn.ṱ; sḥn "befehlen, beauftragen" |   |
| sḫ(.t) "Feld" |  |
| sh̭y.t; sh̭y(.t) "Schlag, Hieb; Rausch" |    |
| sẖꜣ "Schrift" |  |
| sẖꜣ; ⸢sẖꜣ⸣ "schreiben" |          |
| sẖꜣ.w "Schreiber" |  |
| sẖꜣ-ỉšr "syrische Schrift, Aramäisch" |  |
| ssw; ss.w; ⸢ss.w⸣ "Termin, Zeit" |              |
| sḳꜣ "zusammenfügen, sammeln" |   |
| sgrꜣ.w "Herde (o.ä.)" |  |
| st "[enklit. Pron. 3. pl. c.]" |   |
| stbḥ(.t) "Gerät, Waffe" |  |
| stbḥ(.t)-n-ḳnḳn "Kampfgerät, Waffen" |  |
| sṯꜣ.ṱ; ⸢sṯꜣ⸣.ṱ; sṯꜣ "(sich) zurückziehen, wenden" |      |
| sdb "essen" |  |
| sḏy "erzählen" |  |
| sḏm "hören" |    |
| sḏny "beraten" |   |
| sḏr "schlafen" |   |
| šy(.w); šy "See" |    |
| šw "Wert, Nutzen" |  |
| šbi̯.t "Veränderung, Tausch, Entgelt" |   |
| ⸢šm⸣; šm "gehen" |               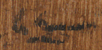        |
| šm.w "Gang, Reise" |  |
| šmsi̯(?); šmsi̯ "folgen, dienen, geleiten" |     |
| šn; šny "Krankheit" |   |
| šn.w "Inspektion, Untersuchung" |  |
| šni̯ "fragen, suchen, untersuchen" |       |
| šni̯ "krank sein" |  |
| šnꜥ "abweisen, abhalten" |  |
| šnt(.t); ⸢šnt(.t)⸣ "Schurz, Tuch" |   |
| šrỉ "Sohn" |        |
| šll; šlly "beten, flehen" | 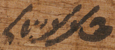  |
| šlly "Wehruf, Wehklage" | 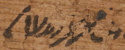 |
| šsp; ⸢šsp⸣ "empfangen" |       |
| Šsp-mr "Schepmer [PN]" |  |
| šgyg "Begier, Verlangen" | 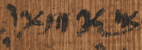 |
| šty "(Priester)einkommen" |  |
| ⸢št⸣y.w "Wald, Busch" |  |
| ḳb "verdoppeln" |  |
| ḳbꜣ(.t) "Gefäß, Krug" |  |
| ḳn "Stärke, Sieg" |  |
| ḳnḥ.t "Schrein, Naos" | 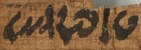 |
| ḳnḳn "schlagen, kämpfen" |      |
| ḳlꜣ.t; ḳlꜣ.w(t) "Riegel, Zapfen" |   |
| ḳlby "[Gefäßbezeichnung bzw. entsprechendes Maß]" |     |
| ḳsy "Mumie; Begräbnis" |  |
| ḳš "Schilf, Rohr" |   |
| ḳd(.t) "Kite (1/10 Deben)" |  |
| ḳdy "umherziehen" |  |
| k.ṱ.t "andere [sg. f.]" |   |
| kꜣm "Garten" | 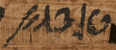 |
| kꜣmy "Gärtner, Winzer" |  |
| kỉỉ.w; kỉỉ "anderer [sg. m.]" |    |
| Kbḏe; Kbḏ "Kambyses [KN]" | 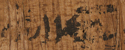  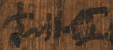    |
| Km; ⸢Km⸣ "Ägypten" |                    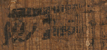        |
| kṱ.t-ẖ(.t) "andere [pl. c.]" |  |
| gy "Gestalt, Art" |   |
| gbꜣ.t "Sproß, Blatt, Nachkommenschaft" | 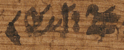 |
| gby.w "Schwacher" |  |
| gmi̯ "finden" |       |
| grp "öffnen, enthüllen, offenbaren" |  |
| grḥe "Nacht" |   |
| glw "deponieren, anvertrauen" |  |
| gsm "Sturm; Zorn" |  |
| gsgs "tanzen" |  |
| gst "Palette" |   |
| gḏwḏꜣ "Mensch aus Gaza, Diener" | 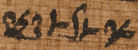 |
| tꜣ "Land, Welt, Erde" |          |
| tꜣ; ⸢tꜣ⸣ "die [def. Artikel sg. f.]" |                                                              |
| Tꜣ-ꜥꜣm(.t)-pꜣ-nḥs; Tꜣ-⸢ꜥꜣm(.t)-pꜣ⸣-nḥs "Daphnai [ON]" |   |
| Tꜣ-Mḥy "Unterägypten" |  |
| Tꜣ-Šmꜥ "Oberägypten [ON]" |   |
| tꜣỉ "[Kopula sg. f.]" |         |
| tꜣỉ "[def. Artikel sg. f. + Präfix der Relativform]" |   |
| tꜣy⸗ỉ "meine" |  |
| ⸢tꜣy⸗w⸣; tꜣy⸗w "ihre" |   |
| tꜣy⸗f "seine" |       |
| tꜣy⸗s "ihre" |    |
| tꜣy⸗k "deine" |     |
| ta "die von" |  |
| Ta-bꜣ.ỉyi̯ "Tabis(?)" | 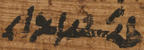 |
| tw⸗ỉ; tw⸗y "[proklit. Pron. 1. sg. c.]" |     |
| tw⸗n "[proklit. Pron. 1. pl. c.]" |  |
| ⸢tw⸣⸗tn "[proklit. Pron. 2. pl. c.]" |  |
| twꜣ "Berg" |  |
| twtw "sammeln, sich versammeln" |  |
| tb "ausstatten, bekleiden" |  |
| tp.t; tp "erster [Adjektiv]" |   |
| tpy.t "Anfang" | 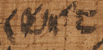 |
| tfy "wegnehmen, entfernen" |  |
| tm "[Negationsverb]" |      |
| tm-hp "Unrecht" |  |
| tmỉ(.w) "Stadt" |  |
| Tryꜣwš "Dareios [KN]" |  |
| ṱrry "Ofen" |  |
| tḥ⸢ꜣ⸣ "Bitternis, Leiden, Krankheit" |  |
| tḥꜣ "betrübt sein, bitter sein, krank sein" |  |
| tḥꜣ "berühren" |  |
| ṱḥs "salben" | 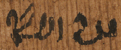 |
| ⸢tḫ(?)⸣ "Trunkenheit" |  |
| tḫ(?)s(.t) "?" |  |
| tš; ⸢tš⸣.w; ⸢tš⸣; tš(.w) "Bezirk, Provinz" |     |
| ṱkn "nahe kommen, eilen" |   |
| tgs.w; tgs "Bauholz" |     |
| ṯꜣi̯ "nehmen, empfangen" |      |
| dwe "Morgen" |  |
| dwn "sich erheben" |   |
| dp-n-ỉꜣw.w(t) "Vieh" |  |
| Dpꜣy; Dpꜣ; Dpyꜣ "Dep (Stadtteil von Buto) [ON]" |    |
| dmḏ "Summe" |         |
| dnỉ(.t) "Anteil" |  |
| dšry(.t) "Rote Krone" |  |
| ḏꜣḏꜣ "Kopf" |     |
| ḏi̯; ḏi̯.t; ḏi̯⸗; ⸢ḏi̯.t⸣ "geben" |                                                             |
| ḏi̯.t st; ⸢ḏi̯.t st⸣ "[Infinitiv + enklit. Pron. 3. pl. c., Haplographie]" |         |
| ḏwf "Papyrus (Pflanze)" |    |
| ḏm "Geschlecht, Nachkomme, Generation; Jungmannschaft; Kalb" |  |
| ḏmꜥ; ḏm⸢ꜥ⸣ "Papyrusrolle, Buch" |     |
| ḏmꜥy "trauern, klagen" | 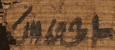 |
| ḏn⸢f⸣; ḏnf "Gewicht, Maß, Gleichgewicht" |   |
| ḏr(.t); ḏr(.t)⸗ "Hand" |    |
| ḏr⸗ "ganz, alle" |    |
| ḏrꜣ; ḏ⸢r⸣ꜣ "stark, siegreich sein [Adjektivverb]" |     |
| ḏlḏ "Pflanzung, Hecke (?)" |   |
| Ḏḥw.tỉ "Thot [GN]" |   |
| ḏsf(.t) "Hypothek" |  |
| Ḏd "Djed-Pfeiler" |   |
| ḏd; ⸢ḏd⸣ "[Konjunktion]" |                                                                                                           |
| ḏd.ṱ; ḏd; (r:)ḏd; ⸢ḏd⸣ "sagen, sprechen" |                                             |
| Ḏd-ḥr "Tachos, Taos [KN]" | 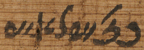 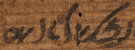 |
| 1; (sw)-1 "Tag 1" |     |
| 10 "10" |  |
| 13 "13" |  |
| 16 "16" |   |
| 160.532 "160.532" | 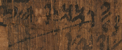 |
| 170.210 "170.210" |  |
| 18 "18" |   |
| 19 "19" | 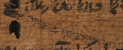  |
| 2 "(Tag) 2" |  |
| 2 "2" |  |
| 2.nw; {2.nw} "zweiter" |   |
| 27 "27" |  |
| 3 "(Tag) 3" |  |
| 3; 3.t "3" |            |
| 376.800 "376.800" |  |
| 4 "(Tag) 4" |  |
| 44; 44.t "44" |   |
| 5 "(Tag) 5" |  |
| 5.t; 5 "5" |    |
| 6 "(Tag) 6" |  |
| 6 "6" |   |
| 6.000 "6.000" |  |
| 7 "7" |  |
| 7; (sw)-7 "(Tag) 7" |   |
| 8 "8" |   |